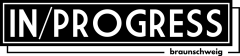(aus: In/Press #4, März 2019)
Auch dieses Jahr erheben sich Frauen* weltweit anlässlich des 8. März gegen patriarchale Strukturen und gesellschaftliche Missstände. Der gegenwärtige feministischer Widerstand reiht sich in eine lange Historie von Befreiungskämpfen und genau als solche sollten sie auch stets verstanden werden. Politische und soziale Rechte wurden nicht durch die Gutmütigkeit der Unterdrückenden gewonnen, sondern stets durch eine Auseinandersetzung erstritten und erkämpft.
Doch der gesellschaftliche Normalzustand dieser Tage zeichnet auch im Jahr 2019 ein wenig emanzipatorisches Bild. Antifeministische, nationalistische und rassistische Positionen finden weithin Anklang, Migrant*innen, Queers & Trans* geraten dabei häufig besonders in den Fokus rechter Hetze. Doch wie führen wir in Zukunft unsere Kämpfe für eine emanzipierte Gesellschaft, fern von Ausbeutung und Patriarchat?
„Daher brauchen wir einen Feminismus (der doch mehr ist als eine Theorie der Geschlechtlichkeit) und eine Klassenpolitik (die mehr ist als eine Theorie der Klassen), die zusammen agieren“, schreibt die Gruppe TOP B3rlin in ihrem Ankündigungstext für die Konferenz ‚Feminism is Class War‘ und bezieht sich hierbei auf den Ansatz der Neuen Klassenpolitik Feminismus, Antirassismus und weitere wichtige Kämpfe nicht getrennt voneinander zu betrachten, sondern konsequent mitzudenken. Warum dies unserer Meinung nach gerade im Kontext des Frauen*kampftages eine vielleicht nicht neue, aber ungemein wichtige Erkenntnis ist, versuchen wir im Folgenden in aller Kürze darzulegen und darüber hinaus ein paar Denkanstöße für den Umgang mit Alltagssexismus zu entwickeln.
We want to break free – smash capitalism, together!
Oft wird auch heute noch mit dem Begriff der Klasse ein stereotypisches Bild des verschwitzten, männlichen Kohle- oder Stahlarbeiters verbunden. Aus feministischer Perspektive kann und sollte dies allerdings längst ad acta gelegt worden sein, nicht zuletzt, da Frauen* immer schon Teil der Arbeiter*innenschaft waren und aktiv Klassenkämpfe austrugen. Viel mehr noch: Die derzeitigen Kämpfe einer neuen Welle feministischer Bewegungen haben eine wiederentdeckte Form der Ausgestaltung: Streiks! Laut Cinzia Arruza (analyse & kritik 464) kommt es dabei zu einem Subjektivierungsprozess einer antikapitalistisch-feministischen Subjektivität und somit sei die feministische Bewegung zum transnationalen Prozess der Klassenbildung dieser Epoche geworden.
In Bezug auf den Begriff der Klasse kann daher nicht von einem starren Konstrukt gesprochen werden, viel mehr wohnt jenem ein steter Wandel inne. Eine getrennte Sicht auf die derzeitige Entwicklung ist daher fehl am Platz, feministische Bewegung und Klassenkampf sollten eben nicht voneinander getrennt betrachtet, sondern gesamtheitlich als feministischer Klassenkampf begriffen werden. Die Ausbeutung durch un- bzw. schlechtentlohnte Reproduktions- und Fürsorgearbeit erfahren in dieser patriarchalen Gesellschaft immer noch mehrheitlich (migrantische) Frauen*. Diese wird gesellschaftlich ebenso strukturell unsichtbar gemacht, wie sexualisierte Gewalt oder sexistisches Verhalten im Alltag, und die dahinter liegenden Denk- und Verhaltensmuster. Es sollte deshalb darum gehen jene historisch gewachsenen Herrschaftsstrukturen offenzulegen und gemeinsam solidarisch gegen sie vorzugehen.
Solidarisch und (selbst-)kritisch!
Eine Sichtbarmachung solcher sexistischer Strukturen durch soziale Medien ist ein weiteres wichtiges Charakteristikum zeitgenössischer feministischer Bewegungen. Durch Hashtags wie #metoo oder #EleNao wurde das Thema Alltagssexismus in die Öffentlichkeit gerückt, globaler diskutiert und ein Stück weit enttabuisiert. Es kann sicherlich ebenfalls von einer gewissen Sensibilisierung der Gesellschaft gesprochen werden. Jedoch halten sich trotz aller positiver Entwicklungen antifeministische Argumente im Diskurs und erhalten oftmals noch immer Zuspruch. Bei aller Euphorie angesichts eines stets wachsenden Diskurses, theoretischer Analysen eines intersektionalen Klassenbildungsprozesses und der konkreten Praxis von Frauen*streiks bleibt also noch viel zu tun.
Denn Übergriffigkeit und die dahinter stehenden Denk- und Verhaltensmuster sind Probleme, die nicht nur in der Gesamtgesellschaft präsent sind, sondern eben leider auch in Kreisen der (radikalen) Linken, in denen nicht selten sexistische Haltungen geduldet werden und so die Machtverhältnisse der patriarchalen Gesellschaft spiegeln. Sicherlich gibt es in linken Zusammenhängen vielfach eine gesteigerte Sensibilität mit diesem Thema, diese trägt aber im Umkehrschluss auch dazu bei, dass linke Gruppen sich als vermeintlich sexismusfreien Raum sehen. Hierdurch entsteht die Gefahr, dass das eigene Bewusstsein für die Aufrechterhaltung und Fortschreibung von historisch gewachsenen Herrschaftsstrukturen in den eigenen Reihen schwindet. Deshalb muss unser Anspruch sein, uns und unser Umfeld immer wieder zu reflektieren, gegebene (patriarchale) Machtverhältnisse zu hinterfragen und die kritische Analyse in gelebte Praxis zu überführen. Feministische Bestrebungen dürfen keine bloßen Lippenbekenntnisse sein, wenn wir es mit einer von uns angestrebten, befreiten Gesellschaft ernst meinen.
Antisexistische Praxis
Doch wie sollte unserer Meinung nach konkret mit sexistischem, übergriffigem Verhalten umgegangen werden? Bedürfnisse und formulierte Forderungen von Betroffenen müssen ernst und angenommen werden. Betroffenen muss ein sicherer, solidarischer Raum für eine freie Entfaltung gegeben werden, Tätern dieser genommen werden. Wir finden aber auch, dass eine Raumwegnahme nicht nur als bloße Bestrafung und Ächtung eines Fehlverhaltens, sondern als Zeit für Reflexion und Veränderung des Verhaltens, verstanden werden sollte.
Diese genannten Muster können von dominantem Redeverhalten, Verwendung von bestimmten Begrifflichkeiten, Aufgabenverteilungen in Gruppen, vom Raumeinnehmen bis hin Grenzüberschreitung und sexualisierter Gewalt reichen.
Wir setzen in unserer idealen Gesellschaft nicht auf Dogmatismus und allwissende Unfehlbarkeit, sondern erhoffen uns vielmehr eine ständige Reflexion über die eigenen verinnerlichten Denk- und Verhaltensweisen, um diese in solidarischer Perspektive zu überwinden. Die intensive Auseinandersetzung mit feministischen Positionen sollte daher nicht nur als Reaktion auf übergriffige Ereignisse stattfinden, sondern als stetig fortdauernder Prozess verstanden werden.