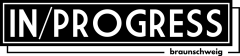Militanter Feminismus in Westdeutschland seit 1968
[Katharina Karcher; Verlag Assoziation A, 2018; 240 Seiten; 19,80 EUR.]
(aus: In/Press #4, März 2019)
Die Geschichte feministischer Kämpfe in Deutschland erscheint auf den ersten Blick sehr gut erforscht. Vielen dürften die öffentlichkeitswirksamen Aktionen vom berühmten Stern-Cover „Wir haben abgetrieben!“ 1971 bis zu den „Slutwalks“ oder der „#MeToo“-Debatte in jüngeren Jahren bekannt sein und stellvertretend für einen zwar provokativen, aber doch weitestgehend friedlichen Feminismus stehen.
Die Rolle militanten Protests innerhalb feministischer Bewegungen oder von Frauen* getragenem politischen Aktivismus in der BRD hingegen ist heute selbst innerhalb linker Kreise deutlich weniger präsent, obwohl auch dieser eine lange, vielfältige Geschichte hat. Jene Lücke in der Geschichtsschreibung möchte die Autorin Katharina Karcher mit ihrem ursprünglich als Doktorarbeit eingereichtem Werk schließen. Um einer (berechtigten) Befürchtung gleich vorweg zu greifen: Dem Buch merkt man diesen Hintergrund im besten Sinne nicht an, sprachlich ist es sehr verständlich gestaltet und lässt sich gut auch am Stück lesen – höchstens an der inhaltlichen Struktur scheint ab und an durch, dass ihm eine wissenschaftliche Arbeit zugrunde liegt.
Das Buch besteht im Kern aus fünf Kapiteln die logisch aufeinander aufbauen. Nach einer allgemeinen Einleitung, in der die Autorin darlegt, wieso Militanz eine wichtige Rolle spielt(e) und in den politisch-zeithistorischen Kontext eingebettet analysiert werden sollte, folgt im ersten Kapitel ein kurzer Abriss über die „Neue Frauenbewegung“ in Westdeutschland. Als weitere Einflussquelle für feministische Militanz werden in zweiten Kapitel die bewaffneten Kämpfe der „Rote Armee Fraktion (RAF)“, der „Bewegung 2. Juni“ sowie der „Revolutionäre Zellen (RZ)“ herausgestellt und eingeordnet. Die RZ sind im weiteren Verlauf von besonderem Interesse, da sich aus ihnen heraus die „Rote Zora“ als eigenständige, militant-feministische Gruppe entwickelte. In den Kapiteln drei bis fünf werden dann auch die Aktivitäten der Roten Zora (und einige weitere militante Protestaktion) im Zusammenhang von drei bedeutenden feministischen Kampagnen näher untersucht: der Bewegung für eine Legalisierung der Abtreibung, dem Kampf gegen Gewalt an Frauen und einer transnationalen Solidaritätskampagne gegen die Ausbeutung südkoreanischer Textilarbeiterinnen.
Die Vielfalt der dabei aufgezeigten militanten Protestformen, von organisierten Fahrten in niederländische Abtreibungskliniken über feministische Walpurgisnachtaktionen zur Rückeroberung der Straßen bis hin zu direkter Gewalt gegen Vergewaltiger und Brandanschläge gegen Konzerne, stellt dabei eine Stärke des Buchs dar. Hilfreich für eine weitergehende Analyse ist darüber hinaus die Differenzierung anhand politischer Motive und Selbstcharakterisierung in drei Typen von Aktivist*innen: (weibliche) Militante, feministische Militante sowie militante Feministinnen.
Katharina Karcher ist mit „Sisters in Arms“ eine wirklich lesenswerte Auseinandersetzung mit politischer Militanz im Kontext feministischer Kämpfe gelungen, die nicht nur vielfach vergessenes oder ignoriertes Wissen über historische, (inner-)linke Auseinandersetzungen wieder zu Tage fördert sondern auch künftige Diskussionen über Ziele, Formen und Strategien von Protest und Widerstand bereichern kann.
Zum Weiterhören:
Für einen kleinen Überblick zu zentralen Thesen des Buches lohnt sich das halbstündige Gespräch von Radio Corax mit der Autorin über die Geschichte der Roten Zora und Diskussionen innerhalb feministischer Kreise in Hinblick auf Gewalt und Gegengewalt: https://www.freie-radios.net/90106