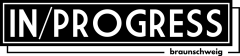Kommentar zum Echo rund um die von ARTE und WDR produzierte Doku zum Antisemitismus in Europa
(aus: In/Press #1, September 2017)
Nachdem WDR und ARTE eine ursprünglich geplante Dokumentation zum Antisemitismus in Europa nicht ausstrahlen wollten und diese daraufhin auf der Website der BILD-Zeitung für 24 Stunden einsehbar war, entbrannte im öffentlichen Diskurs rasch ein Shitstorm mit dem Fazit: Unsachlich, propagandistisch, übertrieben und wehleidig sei die Dokumentation und ihre Ausstrahlung daher nicht zu vereinbaren.
Was die Verantwortlichen von WDR und ARTE bereits im Vorfeld zur Rechtfertigung der Nichtausstrahlung verwendet hatten, wurde schnell von einer Vielzahl an „Kritiker*innen“ übernommen und zunächst nur von einer verschwindend geringen Anzahl an Personen (darunter überwiegend renommierte Antisemitismusexpert*innen) in Frage gestellt.
Nun ist es eine Sache, wenn eine Filmausstrahlung wegen der Verletzung von Persönlichkeitsrechten oder einer nicht hundertprozentigen Faktengenauigkeit nicht ausgestrahlt wird: Das wäre nachvollziehbar und richtig, weil jede*r Recht auf eine auf verifizierbaren Fakten fußende Berichterstattung hat.
Leider scheinen diese berechtigten Gründe bei der Verhinderung der Ausstrahlung von „Auserwählt und Ausgegrenzt“ eine eher untergeordnete Rolle gespielt zu haben, zumal sie auch lange im Voraus ohne größeres Aufsehen durch Kooperation zwischen Macher*innen und Sender hätten beseitigt werden können.
Dass jene Gründe primär vorgeschoben sind, wird für jede*n deutlich, der*die sich einmal genauer mit dem vom WDR auf seiner Internetseite veröffentlichten Faktencheck auseinandersetzt.
Dieser vermittelt zunächst den Eindruck von einer Vielzahl an gravierenden journalistischen Mängeln inhaltlicher Art, von denen sich die meisten bei genauem Hinschauen jedoch als begriffliche Haarspalterei seitens des WDR offenbaren. Bei der Mehrzahl der problematisierten Textstellen handelt es sich nicht um falsche Fakten, sondern schlichtweg um Formulierungsungenauigkeiten.
So etwa wenn Palästinenserpräsident Abbas von den Filmmachern zitiert wird, der in seiner Rede vor dem EU-Parlament behauptet, dass Rabbiner die Regierung in Israel aufgefordert hätten palästinensisches Wasser zu vergiften, um Palästinenser gezielt zu töten. Dies wird in der Doku passenderweise in den Kontext der antisemitischen Legende um jüdische Brunnenvergiftungen gesetzt, was der WDR im Faktencheck wiederum als Verdrehung darstellt, da von Brunnen in dem Zitat keine Rede sei. Eine schier unglaubliche Spitzfindigkeit, die offenbart, wie es um das Antisemitismusverständnis des WDR bestellt ist: Antisemit*in kann anscheinend nur sein, wer auf dem Marktplatz schreiend die Vernichtung von Jüd*innen fordert.
Jegliche historische Betrachtung außen vor lassend entsteht der Eindruck, das Zitat einer Person rechtfertigen zu wollen, die in ihrer Dissertation den Holocaust leugnet – mehr als fragwürdig, zumal an anderer Stelle gerade dieser historische Kontext lautstark besungen wird, um den deutschen Nationalheiligen Richard Wagner in Schutz zu nehmen und dessen glühenden Judenhass zu relativieren. Auch hier versteht man die Aufregung der Produzent*innen nicht: Der Antisemitismus Wagners werde in „der neueren Forschung nun gerade als nicht rassistisch bewertet“ heißt es in dem „Faktencheck“ des WDR. Abgesehen davon, dass der Freispruch Wagners als Rassisten ihn noch lange nicht vom Antisemitismus reinwäscht, ist dieses Plädoyer auch inhaltlich kaum zu halten. Eventuell sollten die Verantwortlichen des WDR einmal einen Blick in Wagners hetzerisches Pamphlet „Das Judenthum in der Musik“ werfen, in dem Wagner Jüd*innen unter anderem als „zersetzende und fremde Elemente“ bezeichnet und sich damit brüstet ihren „Einfluss auf unsere Musik“ bekämpfen zu wollen.
In einem weiteren Ausschnitt des Films geht es dann um die Ernennung Husseinis zum Mufti während der 20er Jahre. Dort heißt es, dass dieser später finanzielle und militärische Hilfe von Hitler erhalten habe, was die partielle Verbundenheit von Islamismus und Nationalsozialismus unterstreichen soll. Aber auch das kritisiert der WDR als falsch, da es erst ab 1937 Kontakte zum nationalsozialistischen Regime gegeben habe, wohingegen durch das Filmzitat der Eindruck entstünde dieser habe sich schon früher entwickelt. An der grundsätzlichen Aussage hingegen ändert diese „Korrektur“ des WDR freilich überhaupt nichts.
Auf diesem Niveau setzt sich der Faktencheck dann bis zum Ende weiter fort und versucht den Film durch zahlreiche „Gegenfakten“ zu diskreditieren. Insgesamt bleibt der Eindruck, dass das einzige Ziel des Faktenchecks darin besteht, quantitativ möglichst viele Einwände gegen die Doku in Stellung zu bringen, um die Haltlosigkeit der eigenen Argumente zu übertünchen.
Der Faktencheck entpuppt sich als ein Zusammentragen fadenscheiniger Begründungen zur Zementierung der eigenen, bürgerlichen Ideologie, nach der Antisemitismus an gesellschaftlicher Relevanz verloren hat und wenn überhaupt am „Rand“ der Gesellschaft auftaucht, bzw. auftauchen darf.
Indem er sich an Formulierungsfehlern hochzieht und einen doppelten Standard in puncto Qualitätskontrolle (siehe Anmerkung*) anlegt, ergreift er einseitig Partei für die Apologeten des Judenhasses.
Zu Gute kommt dieser Diskurs schließlich all jenen, die ihrem Antisemitismus schon seit langem unter dem Deckmantel der Israelkritik freien Lauf lassen und sich nun, dank WDR, darin bestätigt sehen, dass das ganze Thema eh viel zu sehr „hochgeschaukelt“ (Norbert Blüm) wird. Vor der „Auschwitzkeule“ (erneut Norbert Blüm) warnend suhlen sie sich schadenfroh im Rampenlicht.
Ein Blick in die auf die Dokumentation folgende Talkshow bei Maischberger, in der es um die tatsächliche Verbreitung von Antisemitismus gehen sollte, bestätigte diesen Eindruck. Geladen waren CDU-Mitglied Norbert Blüm (eben jener), Gemma Pörzgen („israelkritische“ Journalistin) und Rolf Verleger, für den die Benennung von Antisemitismus „Spiegelfechterei“ ist.
Alle ließen sich für die Beobachtungen Detlev Claussens heranziehen, der in seiner Publikation „Grenzen der Aufklärung“ das Fazit jener Sitzrunde vorwegnimmt und beobachtet: „Die Transformation von antijüdischen Aggressionen in eine scheinbar individuelle Meinung, über die sich demokratisch diskutieren lässt, ist selbst Moment der antisemitischen Praxis.“
Denn egal ob Blüm, der sich Kritik an „Finanzkapital und Israel“ (gerne auch in Verbindung miteinander) nicht nehmen lassen will, oder Pörzgen, die der Ansicht ist, dass muslimische Schüler*innen nichts in KZ-Gedenkstätten verloren haben, da das nicht zu ihrer Kultur gehöre und man mit dem Holocaust nicht „moralisieren“ solle: Beide stellten unter Beweis, dass antisemitische Hetzte nach wie vor salonfähig bleibt, da sie ohne weitere Aufschreie oder Interventionen abends im Ersten verbreitet werden kann.
Das Fazit der Debatte fällt somit wie erwartet aus und konstatiert das stets Dagewesene von Neuem. Antisemitismus, ob in primärer oder sekundärer Gestalt, bleibt Problem, ob in der Linken, der Rechten, der vermeintlichen „Mitte“, im Christentum oder im Islam, in Subkulturen oder bürgerlichen Spießerkreisen.
Angesichts dieser Umstände ist eine radikale linke Kritik des Antisemitismus, sowie eine Absage an krude Kapitalismuskritiken und der aus ihr erwachsenden Personifizierung ökonomischer Strukturen wichtiger denn je, schließlich bilden sie den Nährboden für antisemitische Projektionen. Nicht Zinspolitik und Banken sollten Hauptkritikpunkt der radikalen Linken sein. Sie sollte sich, wo noch nicht geschehen, auf eine grundlegenden und umfassende Kapitalismuskritik besinnen und anstelle von halluzinierten „Lenkern der Welt“ die Warenförmigkeit und Produktions- & Reproduktionsverhältnisse angreifen.
Ansonsten verfällt sie der bürgerlichen Affirmation und verkennt damit die systemischen Zusammenhänge von Kapitalismus und Antisemitismus, bei gleichzeitiger Verherrlichung von Leistung und Arbeit ganz nach autoritärem Prinzip.
Klar ist, dass Kompromissbereitschaft in puncto linker Arbeitsfetischisierung und falscher Kapitalismuskritik Mitschuld trägt an autoritären Sehnsüchten, auch innerhalb der Linken.
Sich selbst als links titulierende Kritik, die im Endeffekt ausschließlich auf Finanzkapital und Konzerne zielt, wird durch ihre Bestrafungswünsche an „denen da oben“ zum gefährlichen Sammelsurium fürs völkisch-reaktionäre und verfällt regressiv auch dem antisemitischen Wahn.
Fest steht leider ebenso, dass sich völkische und arbeitsfetischisierende Kapitalismuskritiken noch einige Zeit hoher Beliebtheit erfreuen dürften, denn „dass die vielzitierte Aufarbeitung der Vergangenheit bis heute nicht gelang und zu ihrem Zerrbild, dem leeren und kalten Vergessen, ausartete, rührt daher, dass die objektiven gesellschaftlichen Voraussetzungen fortbestehen, die den Faschismus zeitigten.“ (Th. W. Adorno)
Insgesamt macht die Debatte rund um die Antisemitismusdokumentation des WDR und ARTE einmal mehr deutlich, wie wichtig die Aufdeckung von Antisemitismus und damit einhergehend die Kritik an bestimmten Formen von Kapitalismuskritik bleibt.
Eine radikale Linke, die sich dieser Debatte entzieht, verliert per se ihren ideologiekritischen Anspruch und geht rückwärts.
Anmerkung
Dieser doppelte Standard zeigte sich zuletzt unter anderem in der Ausstrahlung der Dokumentation ,,Gaza: Ist das ein Leben?“, deren Mitautorin für das eindeutig antisemitische Online-Portal „Electronic Intifada“ schreibt und somit auch in der Doku vehement versucht Israel für alles verantwortlich zu machen: Von angeblichen Massakern bis hin zu der mangelhaften Stromversorgung in Gaza.
Die hier mehrfach hervorgebrachte Kritik an der Doku wird seitens ARTE und WDR jedoch als nicht relevant betrachtet.
Siehe hierzu u.a.: Offener Brief an Arte vom Jüdischen Forum für Demokratie und gegen Antisemitismus
Zum Weiterlesen
- ,,Dialektik der Aufklärung“/ Kapitel: Elemente des Antisemitismus – von Theodor W. Adorno und Max Horkheimer
- ,,Weltkrise und Ignoranz“/ Kapitel: Geld und Antisemitismus – von Robert Kurz
- ,,Grenzen der Aufklärung – Die gesellschaftliche Genese des modernen Antisemitismus“ – von Detlev Claussen