Zur Debatte um Polizeigewalt, Rassismus und Krawallnächte
(aus: In/Press #9, November 2020)
Nach dem gewaltsamen Tod von George Floyd, ermordet von US-Polizisten in Minneapolis, schwappten Trauer und Anteilnahme, aber auch Empörung und Wut, nach Deutschland. In zahlreichen Städten wurde demonstriert, Mahn- und Gedenkkundgebungen abgehalten und eine Diskussion über Rassismus und Gewalt (auch) in der deutschen Polizei angestoßen.
Gerade vor dem Hintergrund immer mehr aufgedeckter rechter Netzwerke in den Sicherheitsbehörden, haben linke, progressive Kräfte unabhängige Kontrollen, die Durchführung von Studien zu Polizeiverhalten und mehr Präventionskonzepte gefordert. Konservative und Rechte haben reflexartig auf den üblichen “Law-and-Order-Kurs” geschwenkt und Kontrollen abgelehnt (die gäbe es ja intern schon genug), Studien nur zu Gewalt gegen Polizei (die wäre ja viel schlimmer und umfangreicher) oder gesamtgesellschaftliche Studien zu Rassismus (sei ja kein polizeispezifisches Problem) zur Diskussion gestellt und Repression als einziges Mittel in Position gebracht. Führende konservative Politiker*innen und Polizeigewerkschafter stellen sich, jeglichen Vorwürfen erhaben, vor “ihre” Polizei und diffamieren Kritik als “pauschalisierend”, “unangebracht” und “Generalverdacht”.
Eine Diskussion wurde schnell abgewürgt und so folgte man erneut dem Credo “Weiter wie bisher”. Dies war auch eine Folge aus dem Aufbegehren gegen Polizeischikanen von Jugendlichen in Stuttgart und Frankfurt und der darauf folgenden öffentlichen Empörung durch gezielte Entpolitisierung, Kriminalisierung und weiterer Marginalisierung der Jugendlichen. Damit wurde der Fokus wieder nur auf Gewalt gegen Polizeibeamte, Zerstörung von Eigentum und etwaigen „Migrationshintergründen“ gelenkt. Wenig Debatten über das “Warum”, und keine Debatte über mögliche Falschausrichtungen von Polizeistrategien oder strukturellem Rassismus und Gewalt. Was verboten sei, gäbe es schlicht nicht, so Innenminister Seehofer. Diese Verleugnungskultur ist in Deutschland traditionell und soll in erster Linie die permanent geschärfte Wahrnehmung der „weißen” Mehrheitsgesellschaft über die Polizei als Beschützerin vor herbeigeredeten “Gefahren” (Kriminalität, Terror, Einwanderung, etc.) festigen. Dies führt zu einer Nichtwahrnehmung der Notwendigkeit institutionellen Rassismus zu untersuchen und zu bekämpfen. Vor allem führt es aber zu einer Verfestigung von rassistischen Strukturen in Staat wie Gesellschaft und einer fehlenden Reflexion des Individuums innerhalb dieser Systeme. So gibt es kaum ein Bewusstsein für die Systematik hinter all den “Einzelfällen” die besonders Mitglieder gesellschaftlich marginalisierter und diskriminierter Gruppen alltäglich erleben.
Es scheint, als bestünde kein politisches Interesse der Regierungen diese Systematik offenzulegen. In dem künstlich geschaffenen, permanenten “Gefahren- und Ausnahmezustand” soll die Polizei als Repräsentantin eines “wehrhaften Sicherheits- und Rechtsstaats” im Gegensatz zur Judikative ad hoc fungieren können. Dabei begibt sie sich aber immer mehr in die Rolle einer Entscheiderin und gleichzeitigen Vollstreckerin über Recht und Unrecht und begeht regelmäßig Grundrechtsverstöße, die ihre eigenen Legitimationsbedingungen untergräbt: die gewaltvolle Umsetzung des demokratischen Willens (Gewaltmonopol) durch demokratische Verfahren. Stattdessen dient die nach Innen wie Außen dargestellt und ausgeübte Gewalt zunehmend zur Selbsterhaltung und Sicherung der eigenen Rolle.
Als Beispiele seien hier Corpsgeist und die Militarisierung der Polizei genannt. Beide führen zu einer Festigung nach Innen, zu einem Gefühl der Überlegenheit und Stärke. Gleichzeitig symbolisiert es Macht und Dominanz nach Außen. Über die Zeit hat sich daraus eine regelrechte “Dominanzkultur” entwickelt, in der die Polizei nahezu ungezügelt illegitime und illegale (physische und rassistische) Gewalt ausüben kann. Dies geschieht auch aus der Sicherheit heraus, nicht (oder wenig) hinterfragt oder kontrolliert zu werden. Die ständige Stützung und Verteidigung der Polizei und das unkritische Hinterfragen ihres Handelns führt dabei zusätzlich zu einer Überhöhung und einem Gefühl der “Unantastbarkeit”.
In Summe haben diese Faktoren zu einer Entmenschlichung der Polizei selbst geführt. Nach Außen eine latent aggressive Maschinerie, die in jeder Situation Dominanz ausstrahlt, sich teilweise hinter Sturmhauben, Helmen mit Visier, Ganzkörperpanzerung, Schilden und Räumpanzern versteckt. Eine bildliche Unnahbarkeit versprühend, eine Distanz erzeugend durch Hunde, Pferde, Schlagstock, Pfefferspray und Wasserwerfer. Nach Innen eine nicht zu brechende Einheit, die keine Schwäche und kein Ausscheren eines Individuums innerhalb dieser Maschinerie duldet. Die eigene Entmenschlichung lässt aber auch leicht eine Entmenschlichung des “Gegenüber” in Einsätzen der täglichen Arbeit zu. Feindbilder sind schnell aufgebaut und verfestigen sich. Klare Abgrenzungen lassen besonders harte Maßnahmen oder Gewalt legitim erscheinen. Grundrechtsverstöße und illegale Verfahren sind akzeptiert oder werden in Kauf genommen. Und das Beste: Restriktionen sind kaum zu erwarten. Ein feuchter Traum jeder konservativer Law-and-Order-Fanatiker*innen.
Aufgrund der ihr innewohnenden Struktur und der rahmengebenden Systematik, in der die Polizei sich bewegt, ist die Einführung von Korrektivfunktionen lediglich ein erwartbarer Tropfen auf den heißen Stein. Kennzeichnungspflicht und Bodycams haben nicht zu einem anderen Verhalten der Polizei in Deutschland geführt, wie erste Untersuchungen belegen. Eventuelle Studien zu Rassismus und Fehlverhalten innerhalb der Polizei, sowie anonyme Meldestellen, würden nur zu weiteren ‘Einzelfällen’ führen. Kapitalistische Krisenlogik und die Schaffung eines permanenten Ausnahmezustands schaffen Rahmenbedingungen, in denen medial aufgebauschte Angstgefühle die konservativen Teile der Gesellschaft einen starken Sicherheitsstaat fordern und frei gewähren lassen. Dass dieser sich dabei jeglicher rechtlicher Schranken entledigt hat, ist fast schon zur akzeptierten Normalität geworden. Ein System, welches auf wenigen Gewinnern und vielen Verlierern basiert, verlangt eben nach einer Instanz wie der Polizei, die mit Gewalt die Eigentumsverhältnisse verteidigt während sie die erfolgreiche Organisation der Vielen verhindert und damit auch die Möglichkeit, alternative Gesellschafts- oder Lebensmodelle zu entwerfen und durchzuführen.
Was also tun? Wir sollten nicht zu viel Kraft in die Behandlung der Symptome stecken, sondern bei der Veränderung unserer Lebensbedingungen ansetzen. Eine Reformierung oder Abschaffung der Polizei unter Aufrechterhaltung des Kapitalismus wird nicht funktionieren. Es benötigt eine Praxis, die Gerechtigkeit und Sicherheit ohne Gewalt schaffen kann. Eine Alternative zum aktuellen Straf- und Justizsystem, in der kritische Situationen und Konflikte gemeinschaftlich aufzufangen und zu bewältigen sind.
Der Philosoph Daniel Loick hat dies vor drei Jahren anlässlich der polizeilichen Gewaltorgien gegen die NoG20-Proteste in Hamburg treffend auf den Punkt gebracht:
“Wenn wir die Möglichkeit geschaffen haben, über die Bedingungen unseres Lebens selbstbestimmt zu entscheiden, dann werden wir auf Gewalt als Medium der Konfliktschlichtung – und somit auf die Polizei als Institution manifester Gewalt – mehr und mehr verzichten können.”
Ein Ansatz dafür soll in der folgenden Ausgabe näher beleuchtet und diskutiert werden. To be continued!
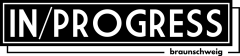

Ein Gedanke zu „No Justice – No Peace“
Kommentare sind geschlossen.