Bei der Vorstellung einer Roboterapokalypse stellen wir uns sofort ein Szenario vor, das dem von Terminator ähnelt. Die Maschinen übertrumpfen die Menschheit und bringen diese an den Rand des Untergangs. Ein dystopisches Bild des Untergangs unserer Gesellschaft, welches selbst in Zeiten der aktuellen Corona-Pandemie nicht unbedingt vor der Tür steht, in der Science-Fiction jedoch gerne aufgegriffen wird. Das ist die populärkulturelle Vorstellung dieses apokalyptischen Bildes.
Im Kapitalismus gibt es da noch eine andere Idee hinter dem Begriff. Wahrscheinlich eher bei der besitzenden Klasse, der Bourgeoise beziehungsweise den Vertreter*innen dieser Klasse, die selber Maschinen und Roboter besitzen. Dort besteht eine verheerende Roboterapokalypse eher darin, dass die Produktivität trotz Automatisierung unwirtschaftlicher wird. Oder anders gesagt, die Fertigungsstätten benötigen kaum noch Menschen und es gelingt dennoch keine Profisteigerung. Also sind die Automatisierung und heutzutage auch die Digitalisierung Prozesse, die gestaltet werden, um die Gewinnmaximierung voranzubringen? Da gibt es, wenig überraschend, zwei Ansichten zu. Ein Interessengegensatz der Heilsversprechen, die uns die Automatisierung offenbart.
Vorweg noch eine kurze Bestimmung, was eigentlich mit Automatisierung gemeint ist. Der technische Fortschritt geht mit dem Menschen einher, seit es ihn gibt. Faustkeil, Rad, Bewässerungssysteme – alles Erfindungen, um Arbeitsschritte zu ermöglichen oder zu vereinfachen. Vom Allzweck-Werkzeug Faustkeil bis zur Roboterapokalypse ist der Weg noch weit, aber mit dem Beginn der ersten industriellen Revolution erfolgte auch ein starker Anstieg bei der Nutzung von Maschinen. Diese erste Phase machte die Dampfmaschine aus, auf die in der zweiten industriellen Revolution das Fließband, und in der später anstehenden digitalen Revolution elektronische Sprünge folgten. Immer mehr Maschinen übernehmen menschliche Aufgaben. Früher waren es einfache, körperlich anstrengende Aufgaben, die übernommen wurden, heute werden ganze Herstellungsprozesse ohne menschliches Zutun organisiert. Meist passiert dies kollaborativ, das heißt, die belastenden Aufgaben werden von Robotern erledigt, während Menschen diese steuern und überwachen. Mensch und Maschine Hand in Hand also. Welche beiden Ideen können sich aus diesem rasanten Fortschritt entwickeln?
Weise, angenehm und gut leben.
Beide Perspektiven setzen voraus, dass es ein Vertrauen in den ständigen Fortschritt als Verbesserung des Ist-Zustands gibt. Aus der Sicht der meisten Menschen, vor allem der proletarischen Klasse, also denen, die ihre Arbeitskraft verkaufen müssen, ist es wünschenswert, dass Maschinen und Roboter den Alltag erleichtern. Das kann in zwei Formen passieren, die idealerweise zwei aufeinanderfolgende Phasen sind. Die menschlichen Entwicklungen seit der Steinzeit haben immer eine Arbeitserleichterung mit sich gebracht. Das heißt, die Belastung für den Menschen auf körperlicher Ebene wird weniger und das sorgt für eine Steigerung der Lebensqualität. Man lebt länger und das in besserer körperlicher Verfassung als früher. Dafür braucht es keinen Blick in die Feudalzeit, selbst unsere Eltern sind größtenteils schon im Alter weniger verbraucht und gezeichnet vom Arbeitsleben, als es bei den Großeltern der Fall ist. Ganz zu schweigen von Arbeitssicherheit, die zumindest in den westlichen Industriestaaten eindeutig in den letzten Jahrzehnten gestiegen ist.
3Das ist der erste Schritt, bei dem, was man von einer Automatisierung erwarten kann. Der zweite Schritt ist dann folgend ein Abbau von Arbeitsaufwand. Das heißt, die Arbeit wird nicht nur leichter, sondern auch weniger. Kurzum, die Wissenschaft kommt auf immer neue Verbesserungen von Prozessen, die es nicht mehr nötig machen, dass die Menschen 30, 40 oder gar 50 Stunden in der Woche arbeiten müssen. Durch die Optimierung dieser Abläufe kann man zugleich viel günstiger und besser produzieren, dass heißt die Menschen können von weniger Geld leben und haben es nicht mehr nötig, ihre Arbeitskraft übermäßig zu verkaufen. Dieser Gedanke ist nicht wirklich neu. John Maynard Keynes, einer der bekanntesten Ökonomen des 20. Jahrhunderts, träumte bereits 1930 von der 15 Stunden Woche. Der Mensch müsste sich dann damit auseinandersetzen, „wie seine Freizeit auszufüllen ist, die Wissenschaft und Zinseszins für ihn gewonnen haben, damit er weise, angenehm und gut leben kann“ [1]. Wenn man bedenkt, dass John Maynard Keynes zwar nach sozialer Gerechtigkeit strebte, aber sich nicht dem Verdacht erwehren musste, die kapitalistischen Verhältnisse überwinden zu wollen, erkennt man eine wirklich starke Hoffnung auf Automatisierung als Geschenk. Roboter als die verlässlichen Arbeitskolleg*innen lassen sich also weiterdenken als die Genoss*innen von morgen? Vielleicht.
Das Glück der Welt liegt auf dem Rücken der Arbeiter*innen.
Warum vielleicht? Die Aussichten klingen doch rosig, wenn selbst kapitalistische Ökonomen zumindest die 15 Stunden Woche im Blick gehabt haben. Am Ende ist es die Realität, die uns wieder einholt. John Maynard Keynes war sich auch sicher, dass es bis 2030 eben diese 15 Stunden Woche geben würde. Drei Stunden am Tag arbeiten? Keine Idealvorstellung, solange man weiterhin für den Profit von Unternehmen seine Arbeitskraft verbrauchen muss, aber doch schon ein großer Schritt in die richtige Richtung. Nun haben wir jedoch noch 10 Jahre vor uns und die 15 Stunden sind soweit entfernt, dass sie wie ein Hirngespinst klingen. Ausgedacht, ohne sich mit den Umständen zu beschäftigen. Wie kommt das, wenn doch Genosse Roboter Seite an Seite mit uns arbeitet und uns mit seinem Einsatz in den verdienten, frühen Feierabend schickt? Es scheitert an den unterschiedlichen Interessen der beiden Klassen. Die 15 Stunden Woche ist eine Utopie, die sich sicherlich auch viele Unternehmer*innen ausmalen könnten, wenn sie als privates Individuum über ein schönes Leben nachdenken, es verstößt jedoch gegen ihr Interesse auf dem Marktes und damit gegen ihr Interesse als wirtschaftliche Akteur*in.
Leider ist dieses Verständnis in die momentanen Verhältnisse fest eingebaut und erklärt damit auch, warum die progressiven Visionen bis heute nicht aufgegangen sind. „Die Bourgeoisie kann nicht existieren, ohne die Produktionsinstrumente, also die Produktionsverhältnisse, also sämtliche gesellschaftlichen Verhältnisse fortwährend zu revolutionieren.“ [2] Überraschend haben Karl Marx und Friedrich Engels schon vor sehr vielen Jahrzehnten das Ganze recht treffend analysiert, obwohl Roboter noch undenkbar erschienen. Wirklich so überraschend?
Eher nicht, die Logik des Kapitalismus ist nämlich bei der Weiterentwicklung von Automatisierungsprozessen und Digitalisierung nicht anders, als bei dem Durchbruch mit Dampfmaschine und Laufbändern. Mehr Gewinn kann nur durch Optimierung der Produktionsverhältnisse passieren und deswegen heißt es auch immer weiter den technischen Fortschritt zu unterstützen. Nach der digitalen Revolution erfolgte ein großer Schritt in diese Richtung, der gerne als Industrie 4.0 bezeichnet wird. Der Begriff wird vor allem am Wirtschaftsstandort Deutschland vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geprägt.
Zum Ziel hat dieses Konzept, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, neue High Tech Strategien zu entwickeln. Der Mensch wird ganz aus den Produktionsabläufen genommen und die Fertigungsmaschinen kommunizieren über WLAN, Bluetooth etc. mit den Produkten, um die Abläufe zu gewährleisten. Das Bundesamt für Bildung und Forschung beschreibt das futurisch auf dem eigenen Internetauftritt so: „Durch das Internet getrieben, wachsen reale und virtuelle Welt zu einem Internet der Dinge zusammen“ [3]. Der größte Wunsch dahinter ist nicht die Möglichkeit, das Arbeitsleben zu verbessern, es ist eine optimale Wertschöpfung. Aus der Perspektive der Bourgeoise ist dieser Schritt nur folgerichtig, denn sonst läuft man Gefahr, dass die Profitmaximierung auf der Strecke bleibt.
Arbeitslos, wo andere Urlaub machen.
Was sind die Konsequenzen daraus? Diese Verbesserung der Wirtschaftsprozesse hin zu dem Konzept von „Smart Factories“, die im Idealfall ohne den Menschen, also die Arbeiter*innen auskommen. Durch die kapitalistischen Verhältnisse, in denen wir leben, sorgt das für eine Verdrängung der Arbeiter*innen aus den Fabriken, ohne das sie aufgefangen werden. Damit kann ein weiterer Fortschritt in diesem Bereich vor allem eine Dystopie für die Mehrzahl der Menschen bringen. Arbeitslosigkeit in großem Ausmaß, welcher nicht einfach durch einen Strukturwandel ausgeglichen werden kann. Wenn man den Wegbruch von Industrie betrachtet, wie es sich bisher abgezeichnet hat, dann ist klar, was geschehen muss. Sei es die alte Motor City Detroit, deren Autoindustrie zusammengebrochen ist, oder das Ruhrgebiet, welches mit dem Ende des Bergbaus strukturell in ein Vakuum gestürzt ist. Es benötigt dort strukturelle Veränderungen, um diesen Regionen wieder zu helfen, im kapitalistischen Wettkampf bestehen zu können. Die Lösung kann vor allem Ansiedlung neuer Branchen sein, von Dienstleistungen hin zu neuen Fabriken. Aus einer emanzipatorischen Politik heraus ist eine solche Umstrukturierung nur eine Stützung der kapitalistischen Prozesse, sorgt jedoch für den Erhalt von erträglichen Lebensbedingungen vor Ort. Eine Entwicklung hin zu „Smart Factories“ auf allen Ebenen, lässt bald den Schritt nicht mehr zu, überall Strukturwandel herbeizuführen.
Es gibt auch Kritik an dieser Entwicklung in Reihen der Bourgeoise, da es auch Untenehmer*innen gibt, die sich mit der steigenden Ungleichheit nicht abfinden wollen. „Wie sich in den USA bereits seit einigen Jahren beobachten lässt, sind es vor allem frühere Apologeten von Finanzkapitalismus und neoliberaler Globalisierung wie Bill Gates oder der ehemalige Chefökonom der Weltbank Larry Summers, die heute vor der Robotisierung warnen. Sie prophezeien, dass die Hauptleidtragenden der neuen technologischen Imperative die prekär, unterbezahlt oder gar nicht Beschäftigten sein werden.“ [4]
Diese Position ist bei weitem kein groß getragener Konsens, eher eine Ausnahme von Unternehmer*innen, die vielleicht die Nachteile des eigenen Handels beobachtet haben, oder sehen, welches Potential an negativen Entwicklungen die noch ausstehenden technischen Fortschritte mit sich bringen können.
Das wahre Grauen ist für die Bourgeoise größtenteils die beschriebene Roboterapokalypse. Investitionen in eine Zukunft, die nicht mehr Gewinne verspricht? Für die besitzende Klasse ein Horror, der realer zu sein scheint, als der technologische Krieg gegen Terminator und Gefolge. Darum ist auch die Idee von John Maynard Keynes verpufft, dass 2030 die Menschen Zeit für Freizeit, Bildung und Freude haben, denn die Maschinen dienen nicht ihnen, sondern dem Profit. Sollten diese Maschinen sie ersetzen, dann gibt es keinen Grund mehr, die Arbeiter*innen zu finanzieren. Für die arbeitende Klasse ebenfalls ein Horror, der näher und bedrohlicher scheint, als die Ausmalungen der Science-Fiction.
Domo Arigato, Mr. Roboto?
nd nun? Arbeitslosigkeit statt rosiger Zukunft für die Arbeiter*innen, wirtschaftliche Abenteuer für die besitzende Klasse? Gilt es somit aus einer linken Perspektive ganz klar zu sagen: Danke für nichts, liebe Roboter? Nein, soweit muss man nicht gehen. Es wäre sogar falsch, so zu denken. Denn der Roboter als skizziertes Sinnbild eines technologischen Fortschritts ist kein Subjekt, der handelt und entscheidet, den man verteufeln sollte, in den man aber auch keine Hoffnung stecken sollte, solange wir im kapitalistischen Zwang stecken. Dietmar Dath betrachtet den Roboter und die weitere Automatisierung als etwas, das beides in sich trägt. Die Idee „erhält Keimformen der Freiheit ebenso gut wie Blaupausen der Unterdrückung, von denen keine je abgegolten, je ganz eingelöst, je ganz überwunden wurde“. [5]
Es gilt also das Potential und die Gefahr in einem zu sehen. Doch das ist keine Seltenheit in unserer Gesellschaft der Widersprüche. Es ist ganz normal im Kapitalismus, dass fortschrittliche Entwicklungen sich am Ende doch gegen das Konzept eines zwanglosen Lebens stellen und die eigene Ausbeutung vorantreiben. Die Maschinen sind nur „Mittel des Kapitals“ die eigenen Interessen durchzusetzen. Dath beschreibt es daher ganz passend: „Zerschlagt die Apparate, aber schützt die Bauanleitungen.“[5]
Aufgrund der Negativtendenzen, die sich durch eine fortschreitende Technologisierung abzeichnen, darf man also nicht zu Maschinenstürmer*innen werden. Diese frühproletarische Bewegung sah ebenfalls den sozialen Verfall durch Verschlechterungen von Arbeits- und Lohnbedingungen und begann Maschinen zu zerstören, um den vorherigen Zustand wieder herzustellen. Diese Bewegung war dadurch fortschrittsfeindlich und stand der Idee entgegen, irgendwann wirklich zu dem Punkt zu kommen, dass Roboter und Maschinen den Großteil der Arbeit übernehmen, damit die Menschen ein gutes Leben führen können. Maschinen können der Schlüssel für eine egalitäre Gesellschaft sein, bei der niemand mehr aufgrund von physischen oder psychischen Unterschieden schlechter als andere gestellt wird.
Auf, auf, die Utopie wartet auf uns!
Und auch aus emanzipatorischer Sicht sollten Roboter nur ein Mittel sein. Ein „Mittel der Befreiung“, die helfen, das schöne Leben zu sichern und eine Erleichterung herbeizuführen. Sie sind aber nicht der Weg in diese Utopie. Kein Roboterheer wird die roten Fahnen schwenken, keine Maschine die Schraubenschlüssel in die Zahnräder der kapitalistischen Fertigungsstellen schmeißen. Die Befreiung bleibt Handarbeit, es gilt den Kapitalismus zu überwinden und die Verhältnisse zu kippen. Ein Unternehmen, welches in der Hand der Arbeiter*innen liegt, kann die dortigen Technologien zum Wohle der Menschen stellen und die Gewinnmaximierung als Ziel ablösen. Der Traum von John Maynard Keynes sah noch immer eine 15 Stunden Woche, die nach kapitalistischen Prinzipien funktioniert, diese Denke ist im Vergleich zu der momentanen Realität natürlich paradiesisch, lässt das System der Unterdrückung und der Gewalt jedoch weiter bestehen.
[1] Keynes, John Maynard (1930): Wirtschaftliche Möglichkeiten für unsere Kinder.
[2] Marx, Karl und Engels, Friedrich (1848): Das kommunistische Manifest
[3] https://www.bmbf.de/de/zukunftsprojekt-industrie-4-0-848.html
[4] Staab, Philipp und Butollo, Florian (2020): „Sündenbock Roboter“ in Le Monde Diplomatique 2/20
[5] Dath, Dietmar (2008): Maschinenwinter – Wissen, Technik, Sozialismus
Literaturtipp: Florian Butollo, Sabine Nuss (Hrsg.): Marx und die Roboter. Vernetzte Produktion, Künstliche Intelligenz und lebendige Arbeit. Karl Dietz Verlag (Berlin) 2019. 350 Seiten. 18,00 EUR.
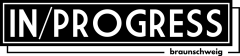

Ein Gedanke zu „Mein Genosse, der Roboter“
Kommentare sind geschlossen.