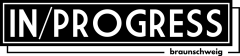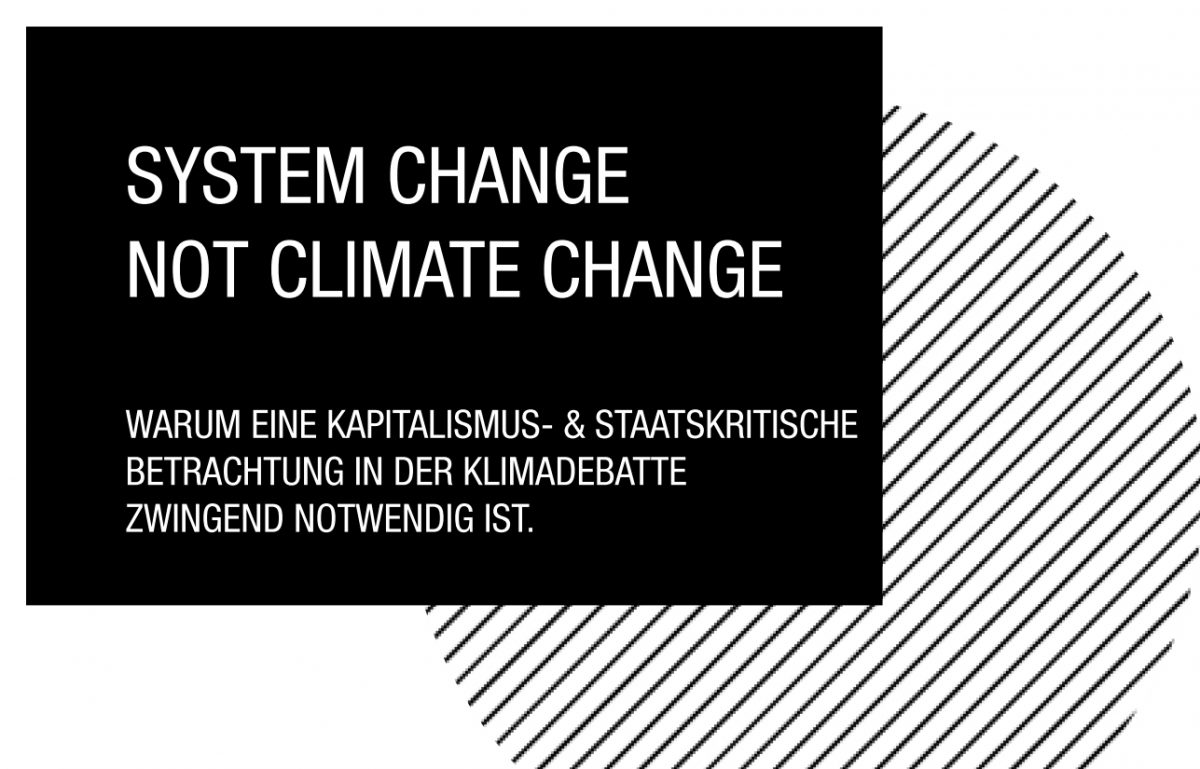[Unser Beitrag zur Klimastreik-Woche Braunschweig im September 2019]
Der Klimawandel bedroht derzeit die Existenz aller auf diesem Planeten. Die Debatten über den Klimawandel bzw. die nötigen Maßnahmen dagegen haben durch die Vielzahl der Protagonist_innen und die Brisanz des Ausmaßes derzeit eine enorme, globale Reichweite und Relevanz. Jedoch finden wir, dass diese Debatte zu oft auf einer Ebene geführt wird, die sich an einzelnen Symptomen und Akteur_innen der Klimakrise abarbeitet, systemische Zusammenhänge der Gesellschaft aber außen vor lässt.
Im Folgenden möchten wir vor allem darlegen, warum für uns eine kapitalismus- und staatskritische Perspektive zwingend notwendig sowie eine Analyse ohne diese unvollständig wäre. Eine umfassende Aufarbeitung des Themenkomplexes würde hierbei selbstredend den Rahmen sprengen, daher möchten wir über diesen Text vor allem progressive Denkanstöße geben und zur Reflexion anregen.
Klimaschutz im Kapitalismus?
Die derzeitige menschengemachte Klimaentwicklung hat ihren wesentlichen Ursprung in der Industrialisierung der Betriebe Ende des 19. Jahrhunderts. Die Maschinisierung der Fertigungsprozesse erlaubte es, in gleicher Zeit viel mehr Waren unter größerem Ressourceneinsatz herzustellen. Wissenschaftliche Untersuchungen legen nahe, dass es einen direkten Zusammenhang zwischen der globalen Erwärmung und dem Ausstoß von CO2 gibt, rund 90 Prozent des CO2 aus nicht-natürlichen Quellen entsteht bei der Verbrennung fossiler Energieträger und der Zementgewinnung.
Trotz dieser eindeutigen Statistiken und Problemlagen bleibt das zugrundeliegende kapitalistische Wirtschaftssystem weitestgehend unhinterfragt. Stattdessen wird durch konservative und wirtschaftsliberale Kräfte sogar nahegelegt, dass nur eine funktionierende Marktwirtschaft die Situation lösen könne und die Debatte um einen Klimawandel bloß der wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit schade.
Und damit sind wir schon mitten im Problem: Grundlegend für den Kapitalismus ist die Entstehung von Märkten auf denen Produkte bzw. Waren oder auch Dienstleistungen unter Konkurrenz gehandelt werden. Entscheidend ist hierbei, dass diese Wirtschaftssysteme auf Gewinnmaximierung sowie Produktionssteigerung ausgelegt sind und somit schon in ihrer grundsätzlichen Form im Widerspruch zu ökologischer Nachhaltigkeit stehen. Wie hängt das alles zusammen?
Kurz gesagt gibt es im Kapitalismus zwei Klassen, die der Kapitalist_innen und jene der Lohnabhängigen, welche nach ihrer Stellung im Produktionsprozess unterschieden werden. Entscheidend hierbei ist, dass die Kapitalist_innen die Produktionsmittel besitzen, während die Lohnabhängigen nur ihre Arbeitskraft zur Verfügung stellen können (und müssen). Um einen Gewinn zu erzielen werden die Arbeiter_innen allerdings nicht vollumfänglich für das bezahlt was sie leisten, sondern um den sogenannten Mehrwert ausgebeutet. Diesen eignen sich die Kapitalist_innen an und investieren ihnen in Teilen neu, um wiederum mehr Profit machen zu können. Der Wachstumszwang führt damit auch zu einem steigenden Einsatz von Energie und Ressourcen. Diese Ressourcen – sowohl die Arbeitskraft als auch die nötigen Werk- und Rohstoffe – müssen dabei erneut weniger kosten als der Verkaufspreis der Waren. Es entsteht also ein Kreislauf.
Dieses Verhältnis birgt Spannungen: Wenn eine Ware nicht mehr den gewünschten Preis erzielt, so kann der Profit nur gehalten werden, indem die Kosten der Herstellung (z.B. Lohnkosten oder klimaschonende Herstellungsverfahren) gesenkt werden. Die Arbeiter_innen haben sich in der Geschichte oftmals durch soziale Kämpfe und Streiks versucht gegen diese Ausbeutung zu wehren. Doch von Unternehmer_innen heißt es dann mit Verweis auf die (Un-)Sicherheit der Arbeitsplätze schnell: Gürtel enger schnallen! Privat vorsorgen! Lohnkürzungen zum Erhalt des Arbeitsplatzes! Eine Verringerung oder gar Abschaffung des Profits würde die Konkurrenzfähigkeit bzw. den Fortbestand des Unternehmens gefährden. Passiert dies großflächig, führt dies zu einer Wirtschaftskrise, die staatliche Intervention erfordert, um – meist erneut auf Kosten der Arbeiter_innen – die wirtschaftliche Stabilität und das kapitalistische Wirtschaftssystem zu erhalten.
Aufgrund der Konkurrenzsituation wird dieser Kreislauf nicht gebrochen und führt zwangsweise zu einer Überproduktion – auch bei fehlender Nachfrage. Es wird nicht für die Bedürfnisbefriedigung produziert, sondern für den Profit. Die Konsequenz ist hierbei eine massive ökologische und soziale Belastung, wie wir sie gerade beobachten können. Über den Klimaschutz nachzudenken heißt somit auch, die Systemfrage zu stellen.
Die bürgerliche Diskussion um das Konsumverhalten
Doch ganz im Gegensatz dazu wird derzeit oft selbstoptimiertes Individualverhalten als Lösung präsentiert und ein “besserer” Konsum angeregt. Passenderweise stehen aufmerksame Unternehmen schon bereit und platzieren Bio- und Fairtrade-Produkte als neues Must-Have. Wenngleich erst einmal nichts daran verwerflich ist, sich Gedanken um den eigenen ökologischen Fußabdruck zu machen, sollten dabei die Leerstellen dieses Fokusses nicht vergessen werden: Wer kann sich dies am Ende überhaupt leisten und wie viel Einfluss hat das eigentlich auf den Klimawandel?
Denn wie schon bei der Ausbeutung der Arbeiter_innen soll auch beim Kampf gegen die spürbaren Auswirkungen des Klimawandels auf individueller Ebene erfolgen, anstatt der systemischen Schieflage auf struktureller Ebene zu begegnen: Während sich die Debatte munter darum dreht, wer aus welchen guten Gründen wie viel und welches Auto fahren darf, oder wie oft und wohin in den Urlaub geflogen werden sollte, wird doch nur ungern darüber geredet, dass der Großteil der CO2-Emissionen nicht aus privatem Freizeitvergnügen entstehen, sondern Resultat einer globalen kapitalistischen Wirtschaftsordnung sind, in der die Warenüberproduktion und deren Transport rein gewinnorientiert organisiert werden. Der Warentransport erfolgt auf Öltankern und Kerosinflugzeugen, da sich die Forschung und der Einsatz elektrisch-regenerativer Antriebe dort finanziell nicht lohnt bzw. kein entsprechenden Gewinn abwirft. Auch die Nahrungsmittelproduktion erfolgt nicht ökologisch nachhaltig, um den Ertrag zu maximieren wird z.B. in Kauf genommen, Böden durch monokulturellen Anbau langfristig unfruchtbar zu machen. An diesem Beispiel lässt sich auch sehen: In der Gesellschaft ist vielleicht bereits der grundsätzliche Wille vorhanden, biologisch nachhaltig angebaute Lebensmittel zu kaufen, jedoch spiegelt sich das im Marktanteil der Bio-Produkte nicht wieder. Der eigene Geldbeutel bestimmt notgedrungen das Kaufverhalten, der Kapitalismus lässt sich letztendlich nicht auf der Konsumebene eines jeden Menschen überwinden.
Die geschilderte kapitalistische Logik legt den Grundstein für eben diesen Klimawandel und muss daher als Ganzes kritisiert werden. Deswegen geht ein grundsätzlicher “climate change” nur mit einem “system change” – weg von einem profit-, wachstums- und konsumfokussierten Produzieren, hin zu einem bedarfs- und gemeinwohlorientierten Wirtschaften.
Capitalism kills our future – beyond Europe
In einer globalisierten, vernetzten Welt zu leben heißt auch: Die Auswirkungen der Klimakrise machen nicht an Landesgrenzen halt, eine Verlagerung der Probleme in anderen Teilen der Welt sorgt am Ende nur dafür, dass als Folge die Lebensgrundlage der Bevölkerungen dort in Gefahr ist und Krieg, Flucht sowie Sterben die Resultate sind. Deutlich wird in diesem Zusammenhang auch ein hierarchisches Verhältnis innerhalb der Klimadebatte: Der globale Norden, also die großen Industrienationen der letzten Jahrhunderte, sind für einen erheblichen Teil der Umweltzerstörungen verantwortlich und haben ihren Reichtum maßgeblich auf Kosten der Länder des globalen Südens aufgebaut. Im Gegenzug sind letztere jedoch deutlich stärker von den Auswirkungen des Klimawandels betroffen. Anstatt dieses Ungleichgewicht solidarisch zu bewältigen, indem die Auswirkungen auch im globalen Süden bekämpft werden, und den dort lebenden Menschen die Grundlage für ein wirtschaftlich selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen, werden die durch die Klimakrise zugespitzten Probleme als wirtschaftlicher Faktor benutzt, um günstig den eigenen Wohlstand zu erhalten – auf Kosten der lokalen Bevölkerungen.
Das Beispiel Wasser zeigt auf, dass auch natürliche Gemeingüter im Kapitalismus zur Ware und somit zum Handels- und Spekulationsobjekt werden. Der Zugang zu Wasser ist ein lebensnotwendiges Grundbedürfnis, aber besonders im globalen Süden, in dem durch Dürren Wasser mitunter ein knapper Rohstoff ist, hat die Privatisierung der Wasserversorgung dazu geführt, dass sich private aber auch staatliche Investoren darauf beschränken, die Wasserversorgung dort auszubauen, wo dies profitabel möglich ist. In Ghana bspw. sind dies zumeist wirtschaftlich starke urbane Gegenden, in denen bereits ein guter Zugang zu Trinkwasser besteht, im Gegensatz zu ländlichen, unterversorgten Gegenden, welche eine Versorgung benötigen, jedoch wirtschaftsschwach sind. Diese Konflikte werden sich bei steigender Durchschnittstemperatur durch den Klimawandel zuspitzen und auch in Europa machen sich erste Auswirkungen bereits heute bemerkbar: Der Grundwasserspiegel der französischen Gemeinde Vittel – bekannt durch das gleichnamige Mineralwasser – sinkt jährlich um 30cm, da Nestlé jährlich 750 Mio. Liter Wasser fördert um sie teuer zu verkaufen. Während die Bewohner_innen des Ortes zukünftig über eine Pipeline von außen mit Frischwasser versorgt werden sollen und zur Sparsamkeit ermahnt werden, wird die Wasserförderung von Nestlé nicht angetastet.
Solange der Zugang zu Ressourcen und Nahrung durch eine privatisierte, kapitalistische Marktökonomie geregelt wird, werden Konzerne und Staaten die eigene Marktmacht durch bspw. Landgrabbing dazu nutzen, die eigenen wirtschaftlichen Bedürfnisse kostengünstig zu befriedigen. Dies sichert zwar den hohen Lebensstandard der reicheren Nationen, tut dies aber ökonomisch (und ökologisch!) auf Kosten wirtschaftlich schwächerer Regionen und entzieht ihnen die Grundlage für die Eigenversorgung. Dies führt zu schlechten Lebensbedingungen vor Ort, wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Destabilisierung und bildet letztendlich den Nährboden für bewaffnete Konflikte und notgedrungene Flucht – was wiederum zeigt, dass ökologische Fragen immer auch zutiefst politische sind.
Staat, Nation, Kapital – sch…wierig!
Nun könnten wir an dieser Stelle aufatmen und sagen: Ja super, dann sollen sich doch Politiker_innen in Deutschland, der EU und den UN um die Probleme kümmern – die wurden schließlich dafür (meistens) gewählt. Warum das falsche Antwort ist, wird nicht zuletzt bei einem Blick auf die aktuelle Tagespolitik deutlich. Denn dass die Bundesregierung in Berlin in Anbetracht der beschriebenen Entwicklungen und parallel zu den großen Klimastreiks ein fast schon absurd unangebrachtes “Klimapaket” verabschiedet hat, darf zwar verärgern, sollte aber nicht verwundern. Denn eine solche Politik ist innerhalb der derzeitigen Rahmenbedingungen eines globalen Wettbewerbs kapitalistischer Wirtschaftsräume und Staaten nur folgerichtig.
Das liegt weniger daran, dass die heute und zukünftig verantwortlichen Politiker_innen per se schlechte Menschen sind (wir möchten das bei einigen von ihnen jedoch auch nicht ausschließen), sondern ist vielmehr in den Spielregeln der bürgerlich-parlamentarischen Demokratie und der Rolle des Staates im Kapitalismus begründet. Diese produzieren systematische Abhängigkeiten und unhinterfragbare Notwendigkeiten, die tendenziell immer zu Entscheidungen zugunsten des Kapitals und zu Lasten der Lohnabhängigen sowie der Umwelt führen.
Dabei ist es nun keineswegs so, dass sich der Staat einfach im Besitz der Kapitalist_innen befindet oder die Bundesregierung persönliche Anweisungen von der VW-Chefetage erhält, mal wieder ein paar Subventionen rüberwachsen zu lassen. Vielmehr existiert ein strukturelles Abhängigkeitsverhältnis zwischen dem Staat (bzw. seinen Repräsentant_innen) und der Kapitalseite. Einerseits garantiert und verteidigt der Staat mit Gewalt (ob in bürokratischer Form durch Gesetze oder in handfester Form von Räumungen durch die Polizei) das Recht auf Privateigentum als Geschäftsgrundlage des Kapitalismus. Denn nur wenn RWE sicher sein kann, dass ihre Landflächen zum Kohlebaggern morgen nicht wieder vergesellschaftet werden, sind sie dazu bereit ihr Kapital langfristig hier zu investieren.
Andererseits ist der Staat vom Erfolg des (ansässigen) Kapitals abhängig, um mit einem Teil des Profitkuchens den eigenen Laden am Laufen halten und gleichzeitig innerhalb der internationalen Staatenkonkurrenz bestehen zu können. Zu diesem Zwecke betätigt sich der Staat quasi als „ideeller Gesamtkapitalist“ in kapitalistischer Krisenverwaltung und sorgt damit dafür, dass sich vor allem die aus seiner Sicht wichtigsten und größten Konzerne bzw. Branchen reproduzieren können. Und die sind, speziell in Deutschland, immer noch in den energie- und ressourcenintensiven Sektoren wie der Stahl- und Automobilindustrie zu finden, die zudem einen große Anzahl von Arbeiter_innen beschäftigen.
Letztlich sind es diese Umstände, unter denen die parlamentarischen Aushandlungen der “Klimafrage” vonstatten gehen, weshalb es kaum überraschen kann, dass als Ergebnis im besten Fall einige kleine Symptombekämpfungen wie Plastikverbote stehen, im Regelfall jedoch eher ein “Weiter so, wir können nicht anders”. Und dies ist auch ein Grund, warum sich mit Konzepten eines “Grünen Kapitalismus”, wie ihn Die Grünen prominent vertreten, oder eines immerhin noch ambitionierteren Plan eines “Green New Deal”, den linkere US-Demokrat_innen derzeit promoten, langfristig höchstens der sprichwörtliche Blumentopf retten lassen wird, da es wesentliche Ursachen des Problems unangetastet lässt: die Eigentums- und Produktionsverhältnisse sowie die daraus resultierenden Machtverhältnisse auf (inter-)nationaler Ebene. Ein grundlegender Wandel ist deshalb nur außerhalb der kapitalistisch verfassten Gesellschaft zu haben, und das ist mit bloßen Appellen an die Herrschenden und Regierenden nicht zu erreichen.
Raise your fist, raise your voice – our future, our choice!
Das hört sich kompliziert an – und das ist es auch. Dennoch zeigen die aktuellen Klimaproteste einige Perspektiven auf, wie ein gesellschaftlicher Wandel gelingen und die Parole “System change – not climate change!” mit Leben gefüllt werden kann. Spannende Aktionsformen wie die massenhaften Kohleblockaden von “Ende Gelände” oder die Besetzung des “Hambacher Forst” verdeutlichen dabei, dass es nicht bei symbolischen Demonstrationen bleiben muss. Wichtig erscheint uns bei alledem, den Kampf um Klimagerechtigkeit nicht als bloße ökologische Frage zu begreifen sondern ebenso als soziale und politische mit der Perspektive eines guten Lebens für alle. Dass darunter zwangsläufig etwas anderes verstanden werden muss, als die neoliberale Idee von Profitlogik und grenzenlosem Wachstum, wird für immer größere Teile der Gesellschaft offensichtlich. Nun gilt es einen Schritt weiter zu gehen und ein solidarisches Miteinander emanzipatorischer Bewegungen gesellschaftlich stark zu machen.
Anknüpfungspunkte dafür gibt es reichlich: In den jüngsten Debatten um die Vergesellschaftung von privatwirtschaftlichen Wohnungsbeständen zeigen sich neue Bruchstellen im Geschäft mit der Ware Wohnraum. Bei den Befürchtungen der Immobilienkonzerne muss es nicht bleiben; auch die Selbstverständlichkeit, mit der die großen Energieunternehmen mit dem gesellschaftlichen Grundbedürfnis nach Strom Profit machen und dabei noch die Umwelt schädigen, darf gerne in Frage gestellt werden.
Damit verbunden ist notwendigerweise immer eine globale Dimension, denn auch die Problemlagen, mit denen wir konfrontiert werden, sind global – sei es beim Thema Klimamigration oder den sozialen und geopolitischen Folgen von Umweltzerstörungen. Als Antwort auf das weltweite Phänomen von Kapitalismus, Klimawandel und dessen gesellschaftliche Auswirkungen muss dementsprechend eine transnationale Vernetzung der Proteste stehen. Ein beeindruckendes Beispiel dafür sind seit Jahren feministische Proteste und Streiks, in denen es immer auch um die grundsätzliche Frage geht, wie wir zukünftig zusammenleben wollen.
Wenn nun also in ähnlicher Weise durch die neuen Klimabewegungen zum “Generalstreik” aufgerufen und Forderungen nach einen grundlegenden Politikwechsel laut werden, kann man das vielleicht als etwas vermessen kritisieren. Besser als es zu belächeln wäre allerdings, die Akteur_innen beim Wort zu nehmen und die Debatte tatsächlich um eine soziale, politische, gesellschaftliche Perspektive zu erweitern und die Auseinandersetzungen dementsprechend zuzuspitzen.
We want it all – and we want it now!
~ In/Progress Braunschweig ~
Zum Weiterlesen:
– Adamczak, Bini (2018): Kommunismus. Kleine Geschichte, wie endlich alles anders wird. 6. Auflage. Unrast Verlag: Münster.
– ak Sonderbeilage zur ak652 (2019): Emission Impossible. Was tun gegen die kapitalistische Klimazerstörung? ak – analyse und kritik: Hamburg.
– Antinationale Linke Bielefeld (2019): no future for capitalism. (https://alibi.noblogs.org)
– Bierl, Peter (2019): Klima oder Kapitalismus. Systemwechsel statt “Green New Deal”. (https://jungle.world/artikel/2019/31/klimaschutz-statt-kapitalismus)
– direction f (2019): System change not climate change. (https://direction-f.org)
– Fuhrmann, Uwe (2019): Ein politischer Klimastreik ist möglich. (https://www.akweb.de/ak_s/ak651/16.htm)
– Grober, Ulrich (2010): Die Entdeckung der Nachhaltigkeit. Kulturgeschichte eines Begriffs. Verlag Antje Kunstmann: Mǘnchen.
– Heinrich, Michael (2005): Kritik der politischen Ökonomie. Eine Einführung. Schmetterling Verlag: Stuttgart.
– Karathanassis, Athanasios (2015): Kapitalistische Naturverhältnisse: Ursachen von Naturzerstörungen – Begründungen einer Postwachstumsökonomie. VSA-Verlag: Hamburg.
– Zelik, Raul (2019): Systemwechsel – Gesellschaft ohne Wachstum. (https://www.woz.ch/1938/systemwechsel/gesellschaft-ohne-wachstum)