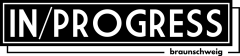Ein Kommentar zur aktuellen Enteignungsdebatte.
(aus: In/Press #5, Mai 2019)
Wenn die FDP nervös wird, haben Linke meist etwas richtig gemacht. Die aktuelle Debatte zu Enteignungen von Immobilienkonzernen ist ein wichtiger erster Schritt, um die selbstverständlich scheinende Hegemonie des Kapitalismus in Frage zu stellen.
New Orleans (USA), 2005: Der amerikanische Traum auf dem Wohnungsmarkt stellt sich als kapitalistischer Albtraum heraus. Wie im Rest des Landes werden Städte und Stadtteile gentrifiziert, das heißt nach einem Leitbild umstrukturiert und aufgewertet, welches attraktiven Wohnraum als Renditeobjekt zu Luxusgütern umgestalten möchte. Um diese Umgestaltung loszutreten, kommt jeder Anlass gerade recht. So explodieren die Mieten seit dem Hurrikan Katrina 2005 in New Orleans enorm und die Naturkatastrophe war nur der Anfang eines großen Verdrängungsprozesses, der folgen sollte. Viele Menschen aus der Unterschicht, die eigentlich davon ausgingen, nach den abgeschlossenen Wiederaufbauarbeiten zurückzukehren, kamen nie wieder in ihre Viertel und auch nicht nach New Orleans selbst. Sie wurden im Umland neu angesiedelt. Ein Verdrängungsprozess, der in dem Ausmaß selbst in den USA neu war, aber wahrscheinlich nicht einmalig bleiben wird. Die Investitionen in den Aufbau kamen deutlich stärker aus dem Bereich der Immobilienbranche als von staatlicher Seite. Durch die Umwälzungen verlor New Orleans das, was es einst ausmachte – neben der sozialen Komponente, hat die Gentrifizierung auch eine rassistische.
In Deutschland ist die Entwicklung zwar vielerorts noch nicht so weit fortgeschritten, aber dennoch zunehmend auffälliger. Die Mieten steigen seit Jahren kontinuierlich an und ein immer größerer Anteil des monatlichen Einkommens wird für die Deckung dieser Kosten genutzt. Die Mietspiegel in den Städten klettern stetig nach oben an und sorgen dafür, dass ganze Viertel teurer werden und dadurch eine starke Veränderung ihrer sozialen Struktur durchleben.
Da seit Jahren dieses Thema im parteipolitischen Diskurs zu kurz zu kommen scheint, wird der Unmut in der Bevölkerung immer größer, denn nicht wenige Menschen sind davon betroffen. Ein frei bestimmtes Wohnen in dem Stadtteil, der einem lieb ist, wird immer mehr zu einem Privileg für Wohlhabende, während der Großteil der Menschen aus finanziellen Gründen dorthin wegzieht, wo sie es sich noch leisten können. Das gerne geforderte Recht auf Stadt wird immer mehr zu einer Utopie als zu Realität. Manche Städte wie München oder Stuttgart sind keine wirklichen Alternativen mehr für Menschen der Unter- und unteren Mittelschicht und selbst in Braunschweig wächst der Druck auf Mieter*innen zusehends.
Wie arg das Problem ist, lässt sich gut daran ablesen, dass – für deutsche Verhältnisse eher untypisch – derzeit offen über alternative und linke Ansätze geredet wird, um die Misere einzudämmen: Auf einmal steht der Begriff der Enteignung im Raum. Damit ist nicht die seit Jahrzehnten übliche Enteignung von Grund und Boden hunderttausender Menschen aus wirtschaftlichen Zwecken, etwa zur Durchsetzung des Braunkohletagebaus, gemeint. Auch die alltägliche gesellschaftliche Enteignung durch den Klassenkampf von oben in Form der Privatisierung von Gemeineigentum oder der Ausbeutung im Arbeitsverhältnis stehen zur Abwechslung mal nicht oben auf der Tagesordnung. Stattdessen diskutiert der politische Betrieb aufgeregt über das im Grundgesetz zwar verankerte, aber in der Bundesrepublik noch nie angewandte Instrument der Vergesellschaftung nach Artikel 15.
Für die bürgerliche Mitte klingt allein das Wort wie ein Schreckgespenst, dass direkt aus der DDR stammen könnte. Seit Jahrzehnten war es hierzulande beinahe undenkbar, mehr als einen zur „sozialen Marktwirtschaft“ verklärten, notdürftig regulierten Neoliberalismus zu fordern. Die gescheiterten realsozialistischen Experimente in Osteuropa und -deutschland werden als Totschlagargument gegen alles genutzt, was die kapitalistischen Eigentumsverhältnisse angreift.
Losgebrochen ist das Ganze in Berlin, wo neben einer wiedererstarkten Besetzungsbewegung das Bündnis „Deutsche Wohnen & Co enteignen“ sich eine klare Agenda zum Ziel gesetzt hat und großen Immobilienkonzernen mittels Enteignungen entgegentreten möchte. Das Ziel ist dabei recht simpel. Es wird ein Volksentscheid gewünscht, der darüber abstimmen soll, ob Unternehmen mit über 3000 Wohnungen enteignet werden sollten, statt zuzulassen, dass sie weiter Wohnraum zur Profitvermehrung anhäufen können. Eigentlich ist die Grundidee noch einfacher runterzubrechen: Die Mieter*innen und Wohnungssuchenden sollen nicht abhängig von wirtschaftlichen Spekulationen werden. Der Gedanke ist dabei nicht wirklich radikal, sondern für einen vorgeblichen „Sozialstaat“ die naheliegendste Art, Wohnraum zu organisieren. Und es zeigt sich, dass sie auf nicht wenig Zustimmung trifft, so hat das Konzept der Enteignung laut Forsa-Umfrage 44% der Berliner*innen überzeugt, womit sie, die Unentschlossenen abgezogen, in der Mehrheit sind.
Diese Zahl schwankt momentan etwas, wird doch im gesellschaftlichen Diskurs von Seiten der FDP, der Union und Teilen der SPD alles getan, um die charmante Idee sich bloß nicht weiterentwickeln zu lassen. Der gerne zitierte bayerische Ministerpräsident Markus Söder meinte dazu: „Enteignungen sind nun wirklich sozialistische Ideen und haben mit bürgerlicher Politik nichts zu tun.“ Da fragt man sich natürlich, was daran denn das Problem ist? Noch kräftigere Töne kommen von seinem Staatsminister für Wohnen, Hans Reichhart. Der hielt fest: „Die ständigen Forderungen aus der linken Ecke nach Enteignungen von Immobilienbesitzern sind eine schwachsinnige Debatte von vorgestern.“ Reine Pöbeleien ohne inhaltliche Punkte, dass klingt nach CSU, aber natürlich sind solche Aussagen dennoch einflussreich in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen. Derweil fordert die FDP gleich mal die Entfernung des Vergesellschaftungsartikels als „Blinddarm des Grundgesetzes“ und die SPD möchte wie so häufig den aktuellen Zustand schlechtestmöglich verwalten.
Dabei sollte die Frage letztendlich doch gar nicht sein, ob enteignet werden soll, sondern in welchem Ausmaß. Gewinnerwirtschaftung durch Mieten und Immobilienspekulation und damit auch mit der Existenz von Menschen, darf niemals eine Option sein. Gleiches sollte dann aber beispielsweise auch für die Arbeitskraft der Lohnabhängigen und ihre Arbeitsplätze gelten. Es ist also immens wichtig, dass die Diskussion vorangetrieben und der Begriff endlich enttabuisiert wird. Je stärker linke Inhalte allgemein wieder präsent werden, desto mehr können die politischen Kräfteverhältnisse insgesamt verändert werden, um zunächst überhaupt dafür zu sorgen, dass sich zumindest im Rahmen der bestehenden Verhältnisse etwas ändert.
Und dann geht vielleicht auch bald wieder ein Gespenst in Europa um, das Lust auf eine solidarische, klassenlose Gesellschaft hat!