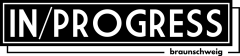Zwischen Konservativer Revolution, “Neuen Rechten” & alten Verbindungen (Teil 2)
(aus: In/Press #2, April 2018)
Nachdem im ersten Teil (siehe In/Press #1) zunächst die zentralen Netzwerke und Akteure dargestellt wurden, geht es im zweiten Text nun um eine Analyse ihrer Strategien und Diskurse.
Es existieren zahlreiche verbindende Argumentationsstränge und Motive, die sich von den Vertretern der ‚Konservativen Revolution‘, also jener Strömung antimarxistischer, antiliberaler, faschistischer Wegbereiter des Nationalsozialismus im Kontext der Weimarer Republik, bis zu der aktuellen Generation der sogenannten ‚Neuen Rechten‘ in Deutschland erstrecken. Manche von ihnen sind beinahe eins zu eins in die heutige Programmatik überführt worden, andere haben einige rhetorische Umwege genommen.
In diesem Zusammenhang kann zwischen Diskursen, die vor allem aus der ‚Neuen Rechten‘ heraus forciert und jenen, die in der ‚Mitte‘ der Gesellschaft unter ähnlichen Vorzeichen geführt werden, von denen Thilo Sarrazin nur ein Beispiel von vielen abgibt, nur schwerlich unterschieden werden. Vielmehr müssen die Wechselwirkungen und ihre ideologischen Gemeinsamkeiten beachtet und betont werden.
Aus der Vielzahl an rechten und rassistischen Diskursen, die derzeit in der Öffentlichkeit zu Tage treten, haben wir im Folgenden einige beispielhaft herausgearbeitet. Im Fokus sollen dabei Diskursfiguren stehen, die typisch für neurechte Argumentationen sind, und nicht nahezu identisch in der extremen Rechten geführt werden, wie beispielsweise der Diskurs um eine angebliche ‚Überfremdung‘ oder ‚Umvolkung‘.
„Schuld-Kult“ / Geschichtsrevisionismus
Der Geschichtsrevisionismus ist salopp gesprochen so was wie der ‚Klassiker‘ unter den neurechten Diskursen. Dabei geht es den meisten von ihnen nicht darum, den Nationalsozialismus zu verherrlichen oder den Holocaust an sich zu leugnen (wenngleich viele dies gerne als legitime Meinungsäußerung straffrei wissen möchten), sondern um die Auswirkungen dieser ‚dunklen zwölf Jahre‘ für die Gesellschaftspolitik im heutigen Deutschland.
Die beliebtesten Stilmittel dafür sind die Täter-Opfer-Umkehr, wie die Behauptung die eigentlichen Opfer des NS-Regimes seien letztlich die Deutschen gewesen, oder die Relativierung. Für Identitären-Chef Martin Sellner etwa steht eine „echte Aufarbeitung des Nationalismus, Faschismus und NS in Europa“ noch aus, wie er 2015 in einem Pamphlet auf dem Blog der Identitären verkündete. Die besteht für ihn darin, jene als „Teilaspekt der Moderne und des Universalismus zu erkennen, statt im NS-Rassenmord eine Modulation des marxistischen Klassenmordes und des liberalen Seelen- und Kulturenmordes zu erkennen und eine insgesamte Überwindung dieser dunklen Epoche vorzubereiten“.
Der Zweck dieser Gleichsetzung und neuen Feindbestimmung ist klar: Die Deutschen sollen von ihrem ‚Schuld-Kult‘ sowie ihrer Stigmatisierung als ‚Tätervolk‘ befreit werden und damit ihre politische und geistige Souveränität zurückerlangen, um für den aufziehenden Bürgerkrieg gewappnet zu sein.
Das Institut für Staatspolitik geht unter dem zynischen Titel ‚Meine Ehre heißt Reue‘ noch einen Schritt weiter und erklärte 2009, „dass es sich bei Schuldstolz und Schuldlust um lebensfeindliche Phänomene handelt. Die deutsche Nation muß unter allen Umständen auf solchen Stolz und solche Lust verzichten, wenn sie nicht an ihr Ende gelangen möchte.“
Die im Ton etwas moderateren Kreise um die Junge Freiheit (JF) konzentrieren sich in ihrer Form der Geschichtsbewältigung lieber auf die ‚positiven‘ Seiten und den Heldenmythos des Hitler-Attentäters Graf Stauffenberg. In Anknüpfung an das in der bundesdeutschen Gedenkkultur ebenfalls unkritische Stauffenberg-Bild, also unter Auslassung von dessen NS-Begeisterung und seinem elitaristischen, antidemokratischen Weltbild, soll ein positiver Bezugspunkt geschaffen werden. Dabei entsteht bisweilen ein bis ins Absurde reichender Heldenkult mit biologistischer Überhöhung, wenn mit Bezug auf Konrad Lorenz von der ‚Spitze des Menschlichen‘ gesprochen wird (vgl. Gießelmann 2016: 134ff). Wohin die Reise gehen soll, offenbart JF-Chefredakteur Dieter Stein 2014 in seinem Leitartikel ‚Es ging um die deutsche Ehre‘: „Dieser selbstlose Einsatz für die Ehre des Vaterlandes ist für uns heute schwer begreiflich. […] Auch dank dieser Tat können wir Deutsche heute aufrecht gehen.“
Political Correctness und die Rede von den „68ern“
Die Debatte um ‚politische Korrektheit‘ ist ein Import aus dem angelsächsischen und insbesondere US-amerikanischem Raum. Ursprünglich als Konzept eines herrschaftssensiblen Umgangs in Sprache und Handlungen gedacht, wurde der Begriff rasch von konservativer Seite gekapert und zum rechten Kampfbegriff gegen vermeintliche Zensur und Unterdrückung umfunktioniert.
Nach Deutschland importiert wurde dieser Diskurs Anfang der 1990er Jahre unter anderem in der Zeitschrift „Criticón“ von Armin Mohler: 1996 produzierte die Junge Freiheit Grafiken mit der Aufschrift „PC? Nein, Danke!“
Mit diesem Begriff transportiert werden sollen die Bilder von ‚Meinungsdiktatur‘, ‚Sprachpolizei‘ und ‚Gesinnungsterror‘, wie Compact-Chefredakteur Jürgen Elsässer bereits 2009 darlegte: „Um es deutlich zu sagen: Die politisch Korrekten sind mittlerweile die größte Bedrohung für Demokratie und Meinungsfreiheit in diesem Land. Sie sorgen für Zensur, weit effektiver als das selige Ministerium für Staatssicherheit.“
Häufig verbunden mit ‚PC‘ als Feindbild wird als Negativfolie alles Schlechte, was mit dem Symbol „68er“ in Zusammenhang steht. IfS-Mitgründer Karlheinz-Weißmann meint damit etwa die „beispiellose Substanzvernichtung und Schwächung all dessen, was noch vor der ‚Dekadenz‘ bewahrte: Stärke der Institutionen und Strenge der Justiz, Verteidigung der Hochkultur und Sorgfalt der Erziehung, Leistungsgedanke und Mißtrauen gegenüber der Utopie“
Der Wunsch besteht in einem Zurück hinter 1968 und am besten auch gleich die Ideen der Französischen Revolution von 1789, zurück hinter die Prinzipien der Aufklärung und der Emanzipation. Eng damit verbunden ist der antifeministische Diskurs.
Antifeminismus / „Gender-Marxismus“
Analog zum ‚PC‘-Diskurs wird in dieser Perspektive auch Feminismus als systematische Männerdiskriminierung interpretiert und gewendet. Männer sind demnach Verfolgte und Benachteiligte, werden ausgrenzt oder gleich ganz mundtot gemacht. Die Forderung nach gesellschaftlicher Gleichstellung, beispielsweise durch das politische Programm des ‚gender mainstreaming‘, habe jedoch nicht nur für den einzelnen Mann negative Auswirkungen, sondern bedrohe am Ende den Fortbestand von Volk und Staat: „Völker, deren Frauen vermännlichen und deren Männer weibisch werden, negieren zwei Grundvoraussetzungen ihres Fortbestands: die Fähigkeit zur natürlichen Reproduktion und zur Selbstverteidigung.“ (Thorsten Hinz in der JF 48/2007)
Ein wiederkehrendes Motiv ist in diesem Zusammenhang die Verschmelzung von männlichem Subjekt und Nation. Erklärtes Ziel ist dann auch die (Wieder-)Herstellung der vermeintlich natürlichen patriarchalen Geschlechter mit all ihren gesellschaftlichen Schlussfolgerungen. Der Verlag Antaios formuliert das 2016 in Bezug auf das übersetzte Buch des Neotribalisten und Maskulinisten Jack Donovan so: „Es geht also – gegen jeden Gender-Trend und gegen jede Verweichlichung des Mannes – um eine Reconquista maskuliner Ideale und um eine Re-Polarisierung der Geschlechter.“
In dieser Vorstellung soll nicht nur die traditionelle Männlichkeit gerettet, sondern gewissermaßen auch die Frau von der Emanzipation befreit und in ihrer Rolle für die Volksgemeinschaft bestärkt werden. Dargestellt wird diese reaktionäre Forderung als ‚Tabubruch‘ und mutiger Akt der Meinungsfreiheit, wie in der 2016 gestarteten Kampagne der Jungen Freiheit unter dem Slogan „Gender mich nicht“.
Das politische Spektrum, welches mit diesen Thesen erreicht werden soll, geht weit über die klassische ‚Neue Rechte‘ hinaus und spricht nach dem Vorbild der französischen ‚Manif pour tous (Demo für Alle)‘-Bewegung nahezu die gesamte konservative bis extreme Rechte aus Unions-Politiker_innen, christlichen Fundamentalist_innen und völkischen Nationalist_innen an.
Eine rassistische Zuspitzung erfährt dieses Vorhaben in jüngster Zeit, beispielsweise in der Identitären-Kampagne „120db“, durch die Verknüpfung von sexualisierter Gewalt gegen (Weiße) Frauen mit dem Bild vergewaltigender, „fremder“ (Schwarzer) Männerhorden.
Vorbürgerkrieg / Widerstand
Die Rede vom ‚Vorbürgerkrieg‘ und einem daraus resultierenden Widerstandsrecht wurde in den letzten Jahren maßgeblich von Götz Kubitschek und dem Institut für Staatspolitik breiteren rechten Kreisen als Kampfbegriff bekannt gemacht.
Deutschland wird dabei an der Schwelle zu einem tatsächlichen Krieg gedacht, die (noch) nicht überschritten wurde. Existent sei jedoch bereits, je nach Lesart, ein „geistiger, ideologischer bzw. ethnischer Bürgerkrieg“, unmittelbar vor dem Ernstfall eines tatsächlichen Kriegs.
Im Jahr 2010 veröffentlichten Kubitschek und JF-Autor Michael Paulwitz ein thematisch passendes Buch unter dem Namen ‚Deutsche Opfer, fremde Täter‘ mit dem sie diesen Ernstfall nahezu herbeisehnen. Im dazugehörigen Internetportal wurde, wie bei heutigen rassistischen Nachfolgeprojekten „Refugee Crime Map“ oder „Einzelfallinfos“, eine Karte von angeblich ‚deutschenfeindlichen‘ Gewalttaten veröffentlicht, mit dem Ziel eine sichtbare, verbildlichte Feindbestimmung einerseits und eine Grenzziehung kollektiver Wir-Bestimmung im Vorbürgerkrieg andererseits zu konstruieren.
Die politische Stoßrichtung dieser Diskursfigur ist eindeutig: „Sie ist Plädoyer und Rechtfertigung für die ‚Zurüstung‘ des Staates zu einem autoritären Staat, der über die nötige ‚brutale Indifferenz‘ verfügt, um insbesondere sein Recht auf Ausschluss gegen missliebige ‚Ausländer_innen‘ durchzusetzen.“ (Gießelmann 2016: 333)
In seiner aktualisierten Form dient der Diskurs der ‚Neuen Rechten‘ zur Behauptung eines aus ihrer Sicht legitimen Widerstandsrechts gegen einen Staat, der dem Wunsch nach autoritärer Zurüstung nicht ausreichend nachkomme. Kubitschek formulierte diese Situation schon 2007: „Die angemessene Haltung des Wahlpreußen von heute dem Staat gegenüber ist die des Getreuen, der die Idee vor der Wirklichkeit retten möchte. […] Er muß bekämpfen, was den Staat zerstört und die Nation kastriert. Das bedeutet nichts anderes, als daß er den Staat von seinen abträglichen Institutionen befreit, ohne die Institution an sich in Frage zu stellen.“
Im Zuge der rassistischen Proteste gegen die Unterbringung von Geflüchteten, bei denen es zu zahlreichen Angriffen kam, formulierte Kubitschek in einer mehrteiligen Serie im Sezession-Blog unterschiedliche Widerstandsschritte als Handlungsanleitungen. Dieser Widerstandsdiskurs markiert letztlich auch den Schritt zur Tat, den einige Protagonist_innen der ‚Neuen Rechten‘ inzwischen bereit sind zu gehen und nicht davor zurückschrecken, sich dabei die Hände selber schmutzig zu machen.
Einiges spricht dafür, dass sie mit dieser Strategie bis tief hinein in bürgerliche, teilweise sogar „linke“ Milieus gewisse Erfolge erzielen konnten: Zunehmende Verflechtungen der parlamentarischen und außerparlamentarischen Rechten, regional erfolgreiche rassistische Mobilisierungen, bei gleichzeitiger Repression gegen linke Strukturen und Gesetzesverschärfungen gegen Asylsuchende sprechen eine eindeutige Sprache.
Antifaschistische Analyse und Praxis sollte jedoch nicht in Schockstarre verfallen sondern diese Entwicklungen aufmerksam verfolgen und entschlossen dagegen handeln. Organisieren wir uns, tauschen uns gemeinsam aus, bringen wir unsere eigenen Diskurse in die Öffentlichkeit und treten den Rechten auf die Füße.
Die nächste Chance dazu bietet sich schon bald bei den Protesten gegen den AfD-Landesparteitag & den NPD-Aufmarsch in Braunschweig am 7. April – wir sind da, und ihr?!
Zum Weiterlesen
- Gießelmann, Bente; Heun, Robin; Kerst, Benjamin; Suermann, Lenard; Virchow, Fabian (Hg.) (2016): Handwörterbuch rechtsextremer Kampfbegriffe.