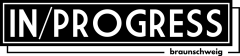»Ein Wahlschein?«, frage ich.
»Das ist, als ob du in den Supermarkt gehst und da wählen kannst zwischen der Tütensuppe von Maggi und der Tütensuppe von Knorr, aber in Wirklichkeit ist alles Nestle. Der Wahlschein suggeriert Freiheit, aber in Wirklichkeit sage ich dir: Alles Kapitalismus, alles Nestle, alles Hähnchen. Da ich nun aber generell keine Tütensuppe essen will, ist mir die Markenwahl im Supermarkt eben schnurzpiepe.«
»Schnurzpiepe?«, frage ich. »Wie meinst’n des?«
»Hast du ‘nen Defekt?«, ruft das Känguru. »Plapperste immer alles nach? Auch was die Herolde des Tütensuppen-Totalitarismus auf allen Frequenzen verkünden: ‘Tütensuppen sind alternativlos! Tütensuppen sind alternativlos!’ Das ist so eklig.«
(Marc-Uwe Kling – Die Känguru-Chroniken)
Die Qual der Wahl im bürgerlich-kapitalistischen Staat
Seit Monaten herrscht Wahlkampf in der Bundesrepublik Deutschland. Vorrangig versuchen Martin Schulz und die sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD), die Christdemokratische Partei Deutschlands (CDU) um ihre Vorsitzende Angela Merkel als Partei mit den meisten Stimmen abzulösen. Allgegenwärtig sind dabei Phrasen wie Fortschritt, Wandel und Gerechtigkeit. Vor allem Schulz bemüht sich redlich um den Eindruck, dass im Falle der Wahl seiner Person zum Regierungschef „sich endlich was verändern“ würde. Mit im Rennen sind zudem Parteien wie Die Linke, die FDP und die Grünen, welche immer mal wieder als mögliche Mehrheitsbeschafferinnen hin und hergedacht werden. Doch spielt es überhaupt eine Rolle, wer am Ende mit wem die Regierungsmacht an sich reißen kann? Oder unterscheiden sich die Parteien im Endeffekt in ihrem Wesen nicht wirklich?
Fakt ist zunächst einmal, dass eine jede Partei – zumindest jede Partei die sich real an der Regierung beteiligt – vom Kapital als solchem abhängig ist. Damit verhält es sich bei jeder Partei, egal ob konservativ, liberal oder links, grundsätzlich gleich. Schließlich lässt sich ein Land innerhalb der kapitalistischen Gesellschaftsordnung nur durch Geld, sprich durch Steuern, aufrechterhalten. Durch jene Steuern schafft der Staat die Grundlage seiner Existenz, ohne sie gäbe es keine Straßen, keine Schulen, keine Kindergärten.
Aber schafft er tatsächlich nur durch sie seine Grundlage oder schaffen nicht vielmehr sie erst die Grundlage für ihn? Schließlich begibt der Staat sich, sobald er auf diese Weise funktioniert, in ein direktes Abhängigkeitsverhältnis. Er benötigt wirtschaftlich starke Unternhemen, die ihrerseits beträchtliches Kapital anhäufen und somit auch entsprechend viel davon in Form von Steuern an ihn abgeben müssen. Es deutet sich also grob an, dass ein Staat ohne starke Wirtschaft nicht funktionieren könnte und jene somit, zumindest größtenteils, eine starke Machtposition hat.
Natürlich lässt sich jenes Verhältnis nicht nur auf dieses Beispiel begrenzen und ist in Wirklichkeit um einiges komplexer: So gibt es auch im kapitalistischen System viele staatliche Interventionen in den Wirtschaftsprozess und nicht umsonst beklagen Unternehmer*innen öfters staatliche Eingriffe in den freien Markt, die Arbeitnehmer*innen und nicht Arbeitgeber*innen zugute kommen sollen, so bspw. die Einführung eines verbindlichen Mindestlohns. So kann es durchaus sein, dass der Staat einzelnen Unternehmen mehr schadet als nutzt, um Arbeitnehmer*innen zu schützen.
Es geht ihm hier jedoch nicht um das schöne Leben für alle, sondern hinter seinem Handeln steht schlichtweg Eigeninteresse: Wenn Arbeitnehmer*innen unter der Last ihrer Arbeit reihenweise zusammenbrechen, gar an der Arbeit verrecken würden (was in anderen Ländern durchaus immer noch an der Tagesordnung ist), würde der Staat seine eigene Legitimation verlieren, bzw. die an der Regierung beteiligten Parteien würden abgewählt werden.
Somit nimmt der bürgerliche Staat gewissermaßen eine vermittelnde Position zwischen Kapital und Bevölkerung ein und sorgt in seiner Rolle als ideeller Gesamtkapitalist dafür, dass das ganze System halbwegs stabil bleibt. Jene sozialen Errungenschaften, die er in diesem Zuge teilweise mitträgt oder zumindestens in Form von Gesetzen zulässt und die nicht selten gegensätzlich zu seinem Grundinteresse erscheinen, sind folglich Teil dieses Konzeptes und verschleiern dabei seine Abhängigkeit vom Kapital.
Jetzt könnte man natürlich fragen, warum das alles so schlimm ist, schließlich hört sich das Ganze doch irgendwie nach einem brauchbaren Kompromiss an. Das Problem ist jedoch, und das hat die Vergangenheit mehr als einmal gezeigt, dass die Interessen der Kapitale langfristig nicht zu “zähmen” sind. Entweder werden Produktionen im internationalen Wettbwerb an für die Produktion günstigere Standorte ausgelagert oder es werden erkämpfte soziale Errungenschaften wieder abgebaut, um größeren Mehrwert erzielen zu können.
Das menschenverachtende – und nur für die Christian Lindners dieser Welt “gerechte” – Leistungsprinzip setzt sich langfristig immer durch und muss sich in unserer aktuellen Gesellschaftsordnung auch zwangsläufg durchsetzten, egal ob bei den Grünen, der CDU oder der Linken (wie nicht nur ein Blick nach Griechenland zeigt). Solange der Staat existiert, agiert er als ideeller Gesamtkapitalist, der kapitalistische Krisenverwaltung betreibt. Und die Parteien unserer parlamentarischen Demokratie können sich vom diesem Abhängigkeitsverhältnis letztlich nicht lösen.
Schaut man sich die Geschichte des Nachkriegsdeutschlands an, werden all jene Überlegungen auch in der Realität konkret sichtbar: So waren die bis heute gravierendsten Sozialkürzungen vom einzigen „Linksbündnis“ zu verantworten. Die Hülle der sozialen Gerechtigkeit der rot-grünen Regierung unter Gerhard Schröder hatte nur solange Bestand, bis das im Zuge der Globalisierung erstarkte transnationale Kapital die miteinander konkurrierenden Staaten zu Steuer- und Sozialdumping zwang. Je mehr die Staatenkonkurrenz in den finanziellen Notstand oder in die Nähe dessen zwang, desto mehr reduziert man sich im Staat auf seinen repressiven Kern, auf die Erledigung des umfangreichen und komplexen Geschäfts der Organisation des Lebens für das Kapital. Infrastruktur und Sozialleistungen wurden zurückgefahren, um den Bedürfnissen des Kapitals zu genügen. Ergebnis dieser Entwicklungen sind in Deutschland beispielsweise die Einführung von Hartz IV und das Verdrängen von immer mehr Menschen in den Niedriglohnsektor und Jobs mit prekären Lohnverhältnissen.
Dabei zeigt sich: Jede Partei ist in dem Sinne konservativ, dass sie sich mit der geltenden gesellschaftlichen Ordnung grundsätzlich einverstanden zeigt. Sie muss den bestehenden Staat und seine Funktion in der kapitalistischen Gesellschaft wollen.
An den allgegenwärtigen Missstände des globalen Kapitalismus wird ein Kreuz in der Wahlkabine demnach nichts ändern, hieran kann nur ein antikapitalistischer Protest etwas ausrichten, der sich von Staats- und Marktliebe lossagt und kollektive Emanzipation an die Stelle von kapitalistischer Vereinzelung setzt . Selbstbestimmtes und solidarisches Zusammenleben aller Menschen ist nur jenseits kapitalistischer Zwänge möglich!
Das große Aber
Trotz alledem sollte natürlich nicht ausgeblendet werden, dass dieses Jahr unter dem Label AfD allem Anschein nach wieder Faschisten als eigene Fraktion in den Bundestag einziehen. Jenem autoritären Rechtsruck, der hierdurch zu befürchten ist bzw. für viele Menschen hierzulande bereits bittere Realität ist, ist natürlich unter allen Mitteln entschlossen entgegenzutreten.
So kann in diesem Sinne der Stimmzettel auch ausnahmsweise einmal für etwas Vernünftiges verwendet werden, nämlich als Gegenstimme zur AfD: Das durch sie drohende Abgleiten in die völkische Barbarei und den Menschenhass stellt in unseren Augen bei der kommenden Bundestagswahl, bei aller notwendigen grundsätzlichen Systemkritik, die mit Abstand größte Gefahr dar.
Deshalb: Macht euch stark gegen Rassismus und Ausgrenzung, sowie die Verwertungslogik des Kapitals. Für die befreite Gesellschaft, Kampf der Barbarei!
»Ob und wen alle diejenigen wählen, die im Prinzip
mit der geltenden Staatsordnung einverstanden
sind, scheint mir sehr wenig belangvoll. Jedes
Parlament, ob seine Mehrheit links oder rechts vom
Präsidenten sitzt, ist seiner Natur nach konservativ.
Es kann nichts beschließen, was den
Bestand der heutigen Gesellschaft gefährdet, also
auch nichts, was denen, die unter der geltenden
Ordnung leiden, nützt.«
(Erich Mühsam – Humbug der Wahlen)