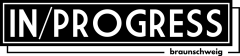[Bini Adamczak, UNRAST Verlag, Münster 2007, 159 Seiten, 12,00€]
(aus: In/Press #1, September 2017)
,,Man muss die Politik der Anführungszeichen aufgeben; also nicht mehr sich aus der Affäre ziehen, indem man den sowjetischen Sozialismus mit schimpflichen und ironisierenden Anführungszeichen versieht, die den guten, den wahren Sozialismus – ohne Anführungszeichen-, (…) in Schutz nehmen“ (Foucault)
Rund 18 Jahre nach historischem Ende des real existierenden Sozialismus bleiben die Fragen nach den in seinem Namen verübten Verbrechen bestehen. An jene Verbrechen gemahnen schmerzlich seine Subjekte und klagen aus der Vergangenheit das Recht auf Befreiung ein, welche für sie immer zu spät kommen wird.
Adamczak versucht in ihrem Buch diesem Unrecht auf die Spur zu kommen und möglichst viele Momente desselben herauszustellen, wozu sie sich auf eine rückwärtsgewandte Reise durch die Geschichte der Sowjetunion von 1939 bis zur Oktoberrevolution 1917 begibt, in der sie die vom Vergessen Verschluckten zum Leben erweckt und versucht ihnen eine Stimme zu geben: All jenen Kommunist*innen die für die Freiheit kämpften und sie dabei verloren, Kommunist*innen deren Stimme verbannt wurde in Arbeitslager wie die in Karaganda oder auf den Solowezki-Inseln .
Gleich zu Beginn demonstriert Adamczak die Notwendigkeit einer gerne verdrängten Aufarbeitung der Vergangenheit, indem sie historisch bei der Auslieferung von Jüd*innen und Antifaschist*innen durch die Partei an die Nazis in den Jahren 1938/39 ansetzt und die anfängliche Kooperation Hitlers und Stalins aufzeigt.
Das Buch setzt bei Genoss*innen ein, die eingepfercht in enge Zugabteile von Moskau direkt nach Deutschland gebracht werden, Genoss*innen die nach Russland geflohen waren, um gemeinsam gegen den deutschen Faschismus zu kämpfen und nun von ihren vermeintlichen Genoss*innen jenem erneut und meist zum letzten Mal ausgeliefert werden.
Ausgeliefert werden sie ohne rational ersichtliche Gründe, vielmehr, wie Adamczak verdeutlicht, als Gastgeschenk an Hitler, auf welches unter Hakenkreuzflagge und zum Horst-Wessel-Lied später fröhlich angestoßen wird und auf das Stalin seinen Toast ausbringt: ,,Ich weiß wie sehr das deutsche Volk seinen Führer liebt, ich trinke auf sein Wohl.“
Ausgeliefert werden sie, um den deutschen Einsatzstab zu beschwichtigen, aus Angst vor einer vorschnellen Konfrontation, ausgeliefert werden sie aufgrund fadenscheiniger Spionagevorwürfe, oder weil sie Kritik an der Parteilinie äußern und Zweifel hegen an der Rolle des Proletariats, nachdem sie dessen Rolle bei der Machtergreifung der Nazis gesehen haben.
Ausgehend von jenen, für Uneingeweihte unglaublich anmutenden Geschehnissen, beginnt das Buch nach den Ursachen der Entwicklung einer Partei zu forschen, die im Namen des Kommunismus Kommunist*innen an den deutschen Faschismus ausliefert.
Und es kommt zu einem deutlichen Fazit, zu einer Anklage gegen all jene, die sich mit ihrer völkischen und arbeitsliebenden Kapitalismuskritik auf der sicheren Seite wähnen, gegen alle die, die einen Sozialismus der Zukunft denken, ohne den Gewesenen zu sehen.
Das Buch wird zur Aufarbeitungschance einer desillusionierten Linken, indem es die Fehler von gestern, heute und morgen aufdeckt, sowohl die der Theorie, als auch die der Praxis und deutlich macht, dass beide auf ewig beschädigt bleiben werden aufgrund ihrer Vergangenheit.
Adamczak versucht das Konglomerat aus Führerkult, politischer Religiosität und nach wie vor kapitalistisch anmutender Verwertungslogik aufzudecken, das seit Tag Eins den real existierenden Sozialismus begleitet.
Sie kritisiert dessen Arbeitsfetisch, der einhergeht mit dem Ausschluss von ,,asozialen Elementen“ und entdeckt in der reaktionären Gleichheit der Partei, einer Gleichheit, die durch Ausschluss zum Bollwerk des Dogmas wird, eine ,,Nachahmung des kapitalistischen Geld- und Warenfetischs.“
Auch geht sie auf die Verfolgung von Schwulen ein, die für sie ebenfalls Symptom einer ,,libidonösen Ökonomie des Stalinismus“ ist, welche ,,von der Lust an der Denunziation, an der Bestrafung ebenso zu leben scheint, wie von der Lust an der Beichte, an der eigenen Unterwerfung.“, die in ihrer Hedonismusfeindlichkeit und ihrem Asketismus gegen ,,sexuelle Ausschweifungen wie Abschweifungen agitiert (…)“
Adamczaks Analyse der Sowjetunion bleibt somit hochaktuell und unterstreicht die Wichtigkeit einer aufklärerischen Linken, die ihre Eitelkeit und Verdrängungsmechanismen in Bezug auf die Vergangenheit überwindet und durch kritische Reflexion ihrem emanzipatorischen Charakter gerecht wird.
Neben all jenen, gut gelungenen Analysen leistet das Buch dennoch überwiegend Trauerarbeit, auch durch seinen Grundton der Leere, der Schwere und der alles umfassenden Resignation.
Dies ist jedoch seine Stärke, denn es entrinnt hierdurch glaubwürdig der Gefahr einer erstarrten und rationalisierten Erinnerung und somit auch einer Relativierung, wie sie sonst so gerne im innerlinken Diskurs mitschwimmt.
Adamczaks Resümee ist radikal und es ist frustrierend.
Es macht mit aller Deutlichkeit klar, dass jene im Namen der Menschlichkeit gegen die Menschlichkeit begangenen Verbrechen des Stalinismus nicht einfach zu historisierende Momente falscher Theorie sind, sondern unmittelbar verknüpft mit dem Kommunismus als solchen, wodurch es an seinem makellosen Antlitz kratzt: ,,Wenn wir Stalins Kopf von Marxens Wange schneiden (..), dann bleibt dort für immer eine Wunde, die nie verheilen wird.“
Dennoch trägt die radikale Aufarbeitung in ,,Gestern Morgen“ die Hoffnung auf ein Anderes in sich wie wenig andere Lektüren zu dieser Thematik, gerade da sie das Gewesene nicht beschönigt.
Weder läuft die Autorin in die Arme eines sehnsüchtig wartenden Konservatismus, noch setzt sie sich im entferntesten der Gefahr des Antikommunismus aus.
Diesen greift die Lektüre vielmehr als Verharmlosung an, zurecht, denn ihm dient die Trauer als Maske, hinter der sich meist die instrumentalisierende und schadenfroh grinsende Fratze des Faschismus verbirgt.
Adamczaks Buch gibt Trauer und Hoffnung, es hat trotz seines mittlerweile zehnjährigen Alters nicht an Aktualität eingebüßt.
Es bleibt nach wie vor lesenswert und wichtig.